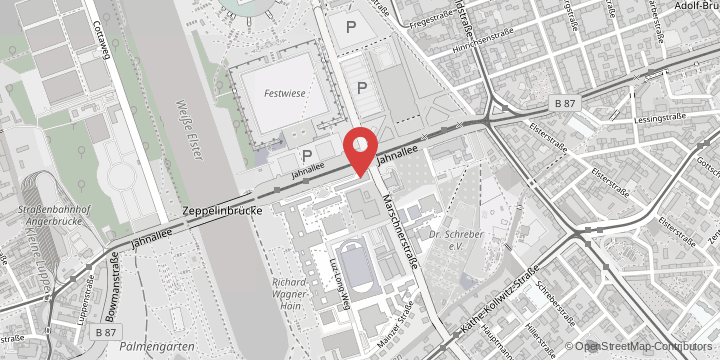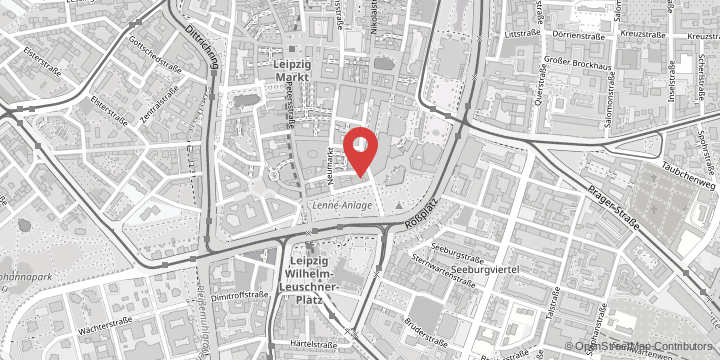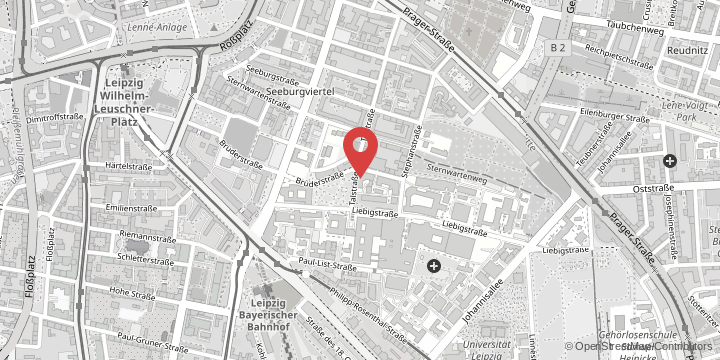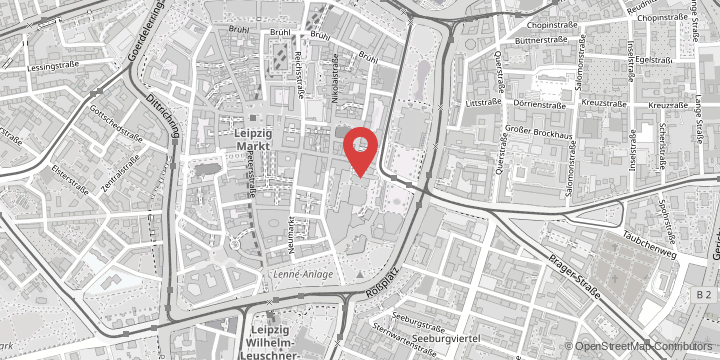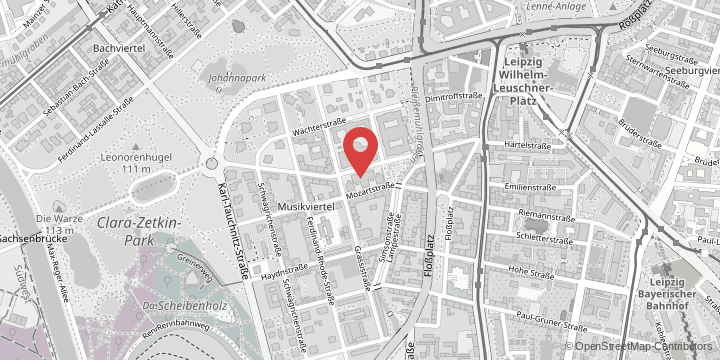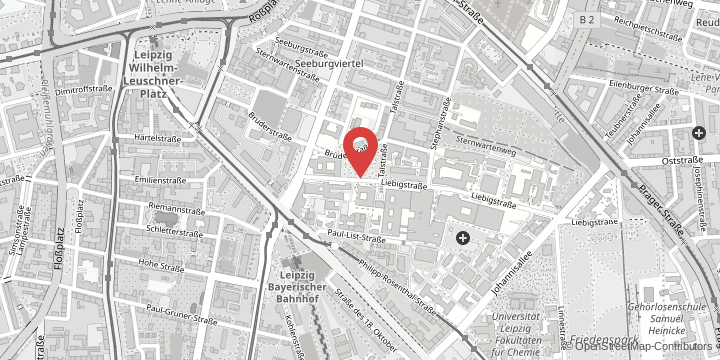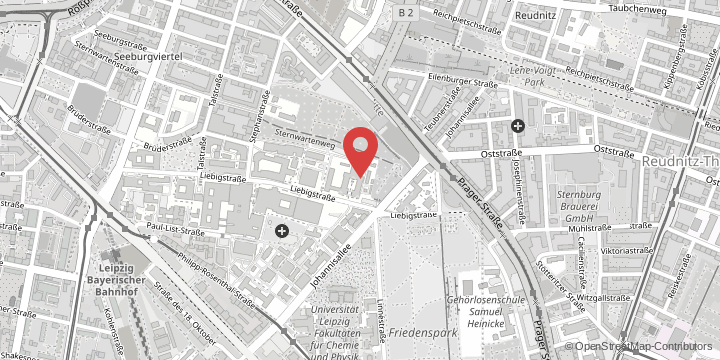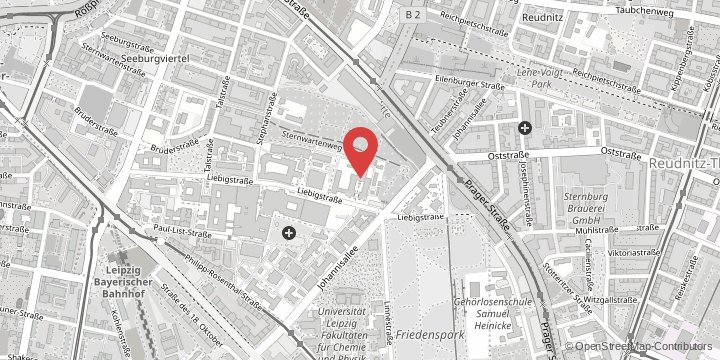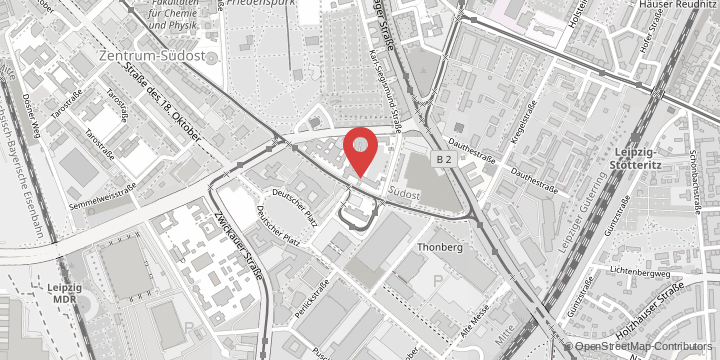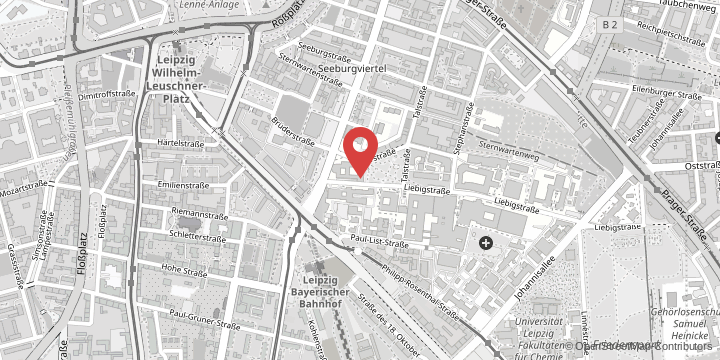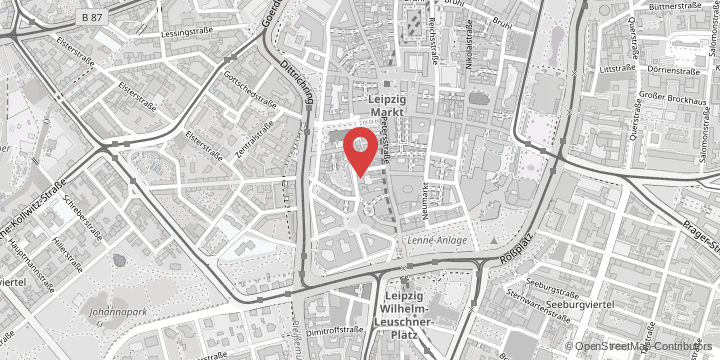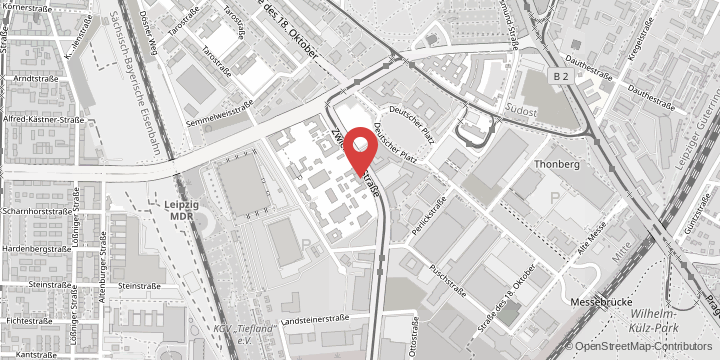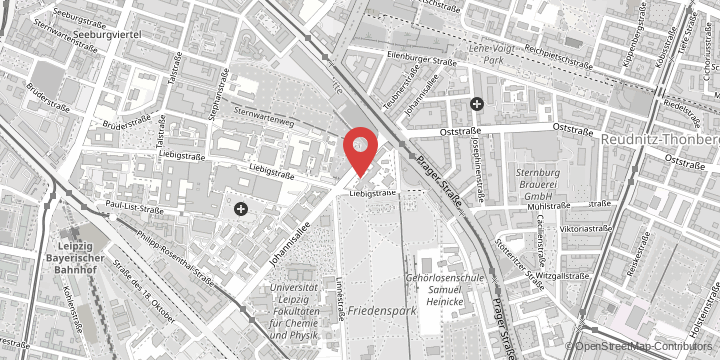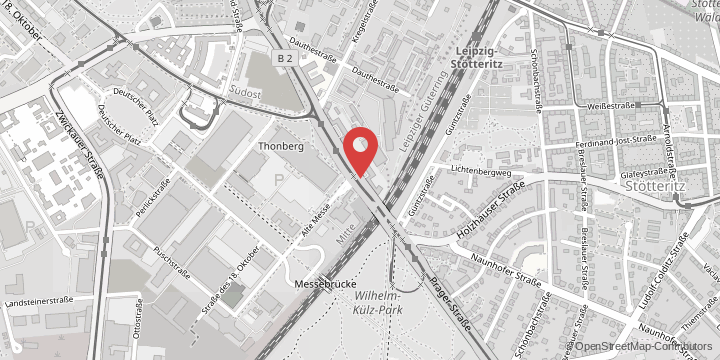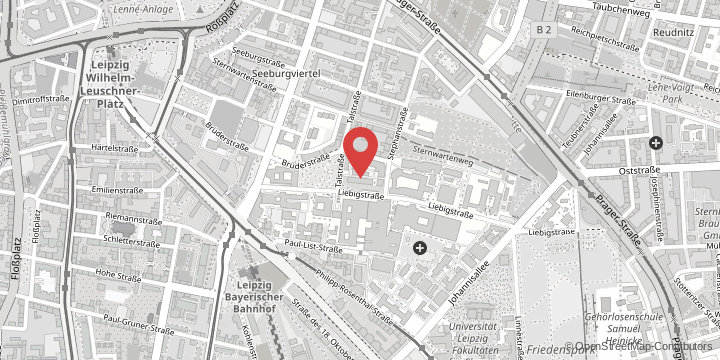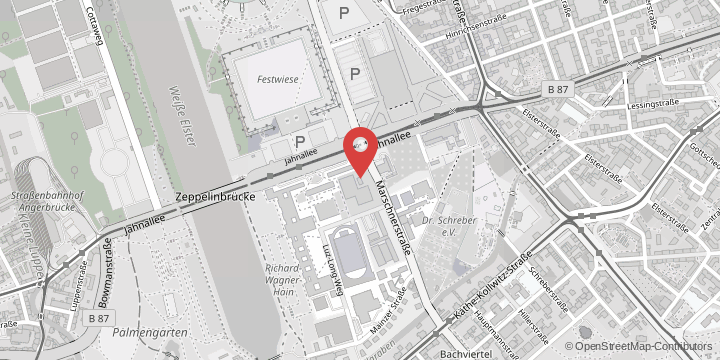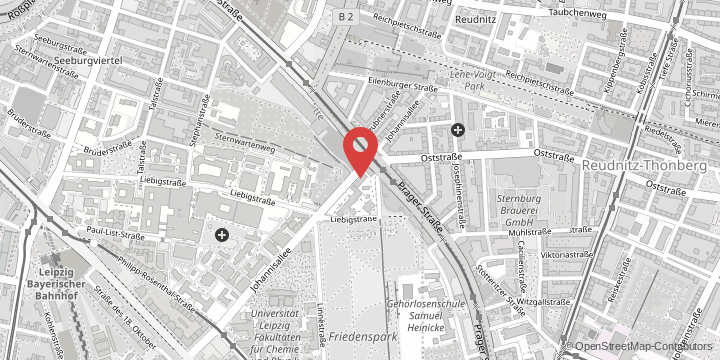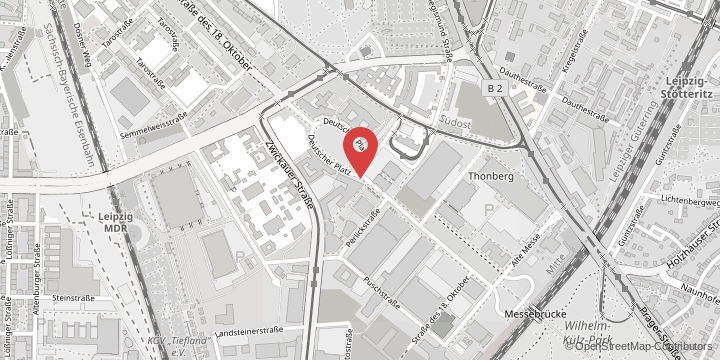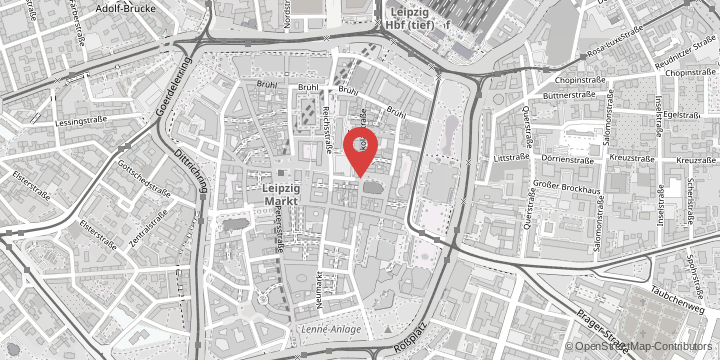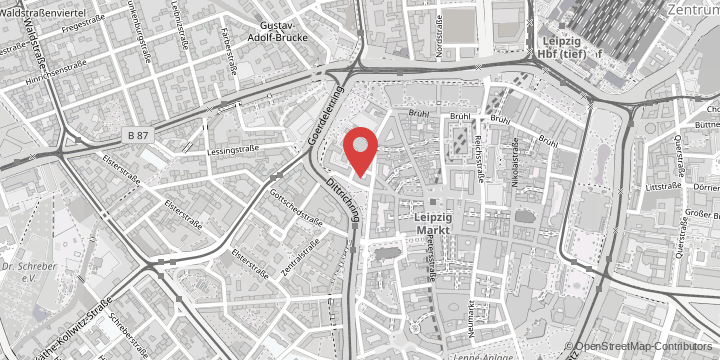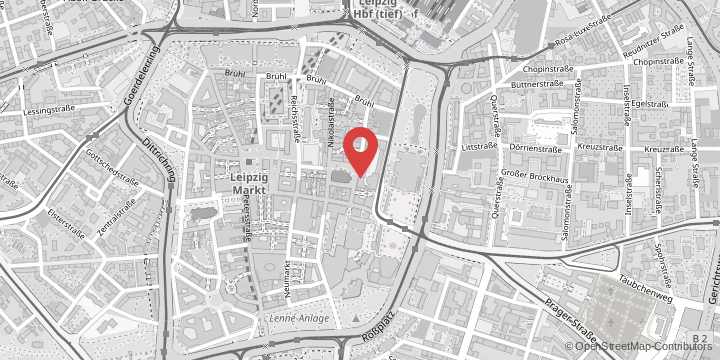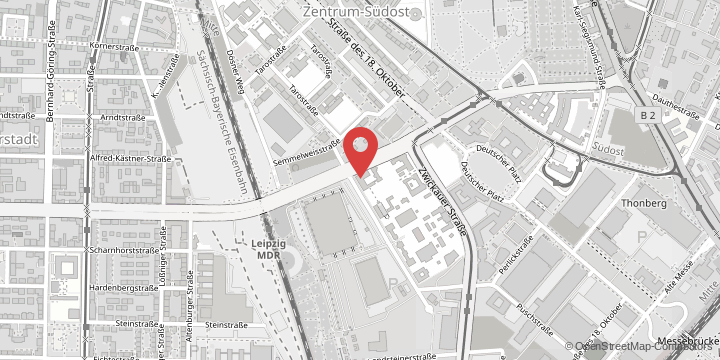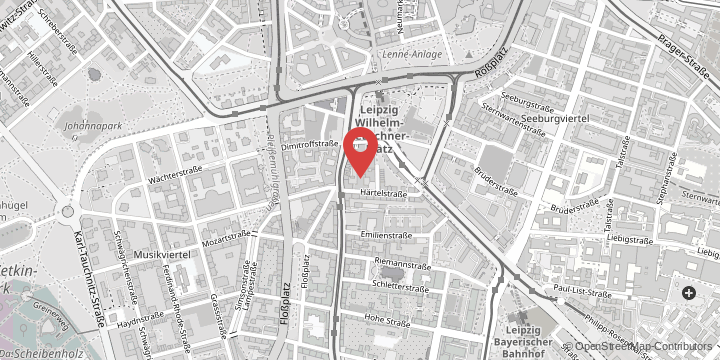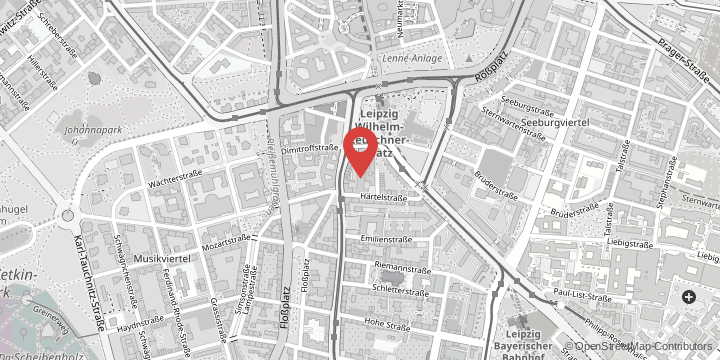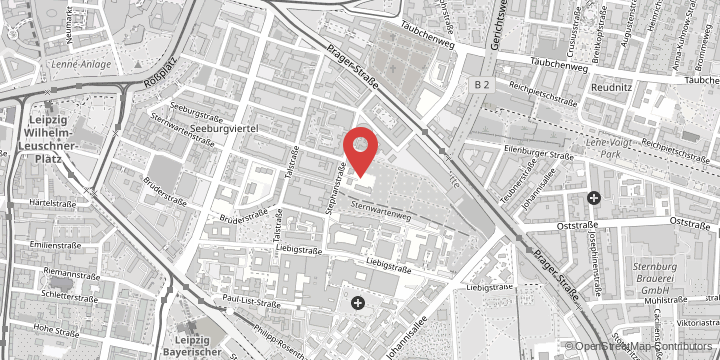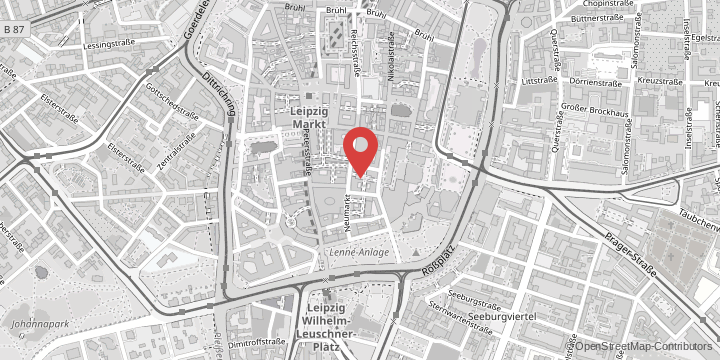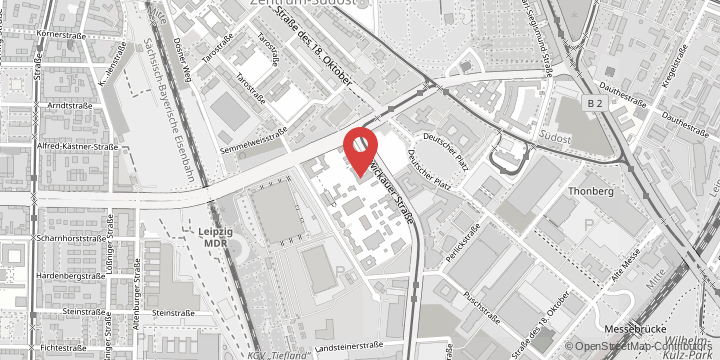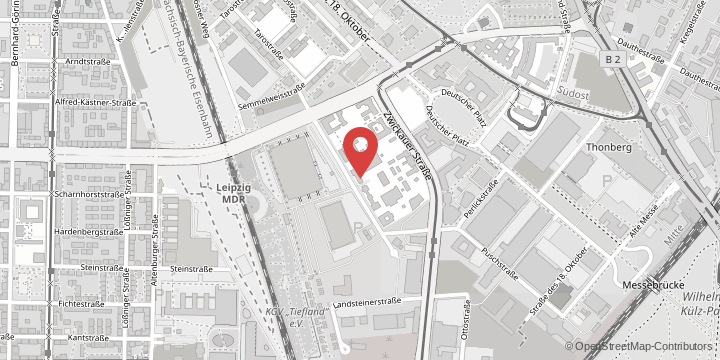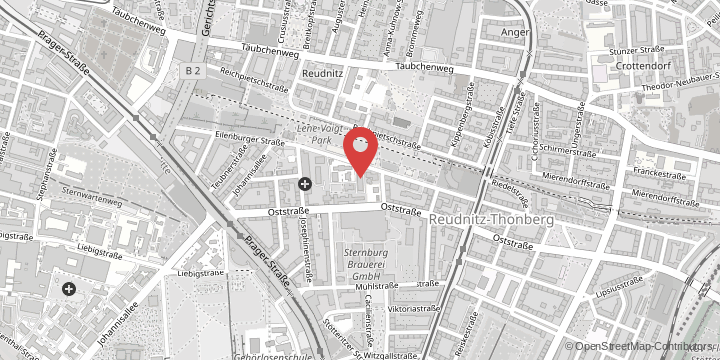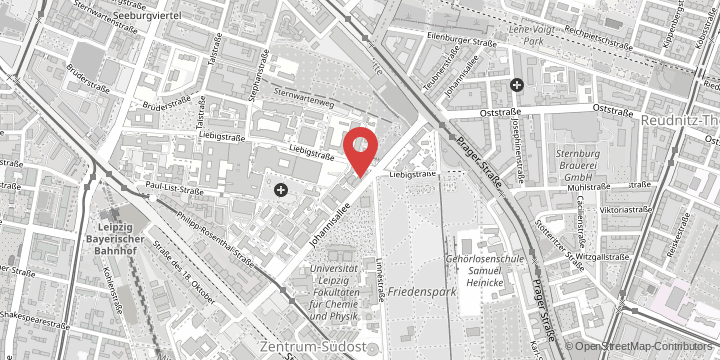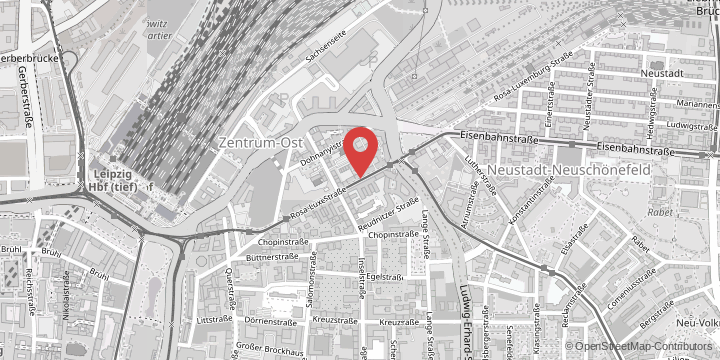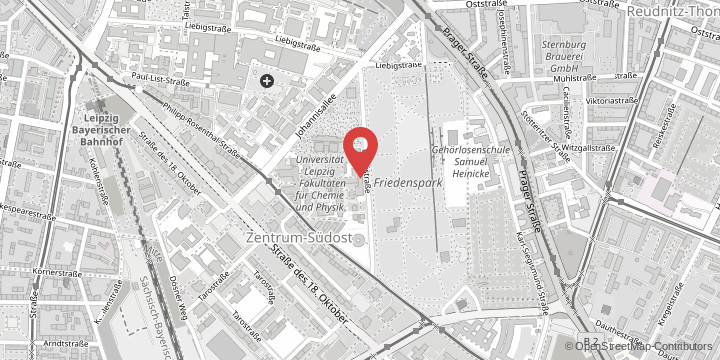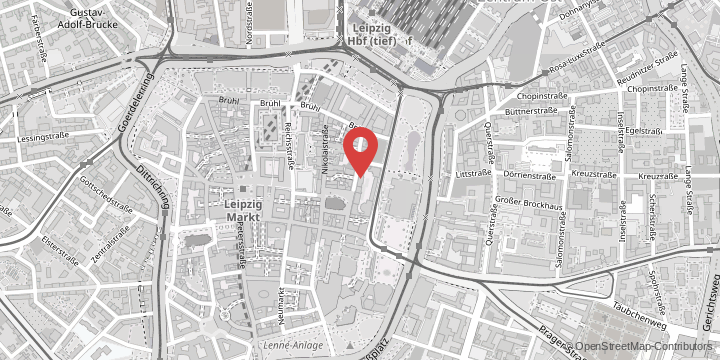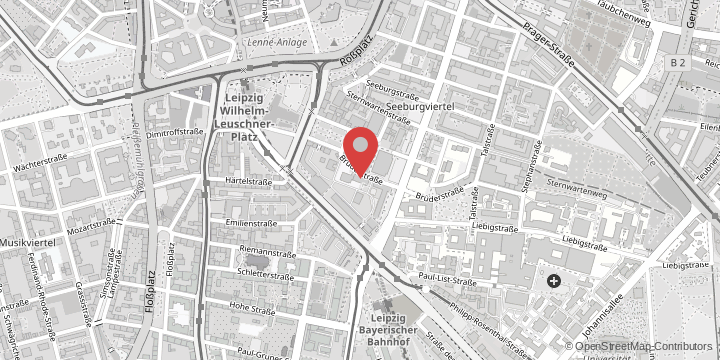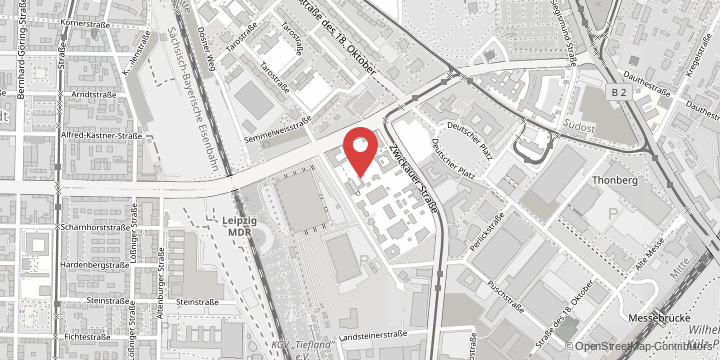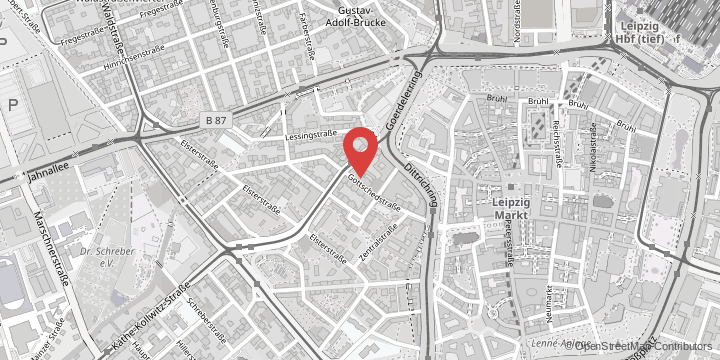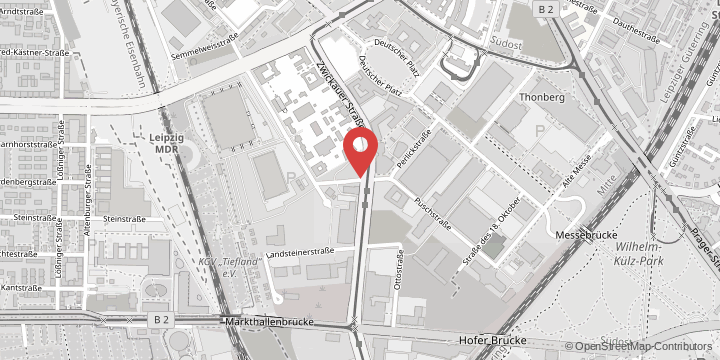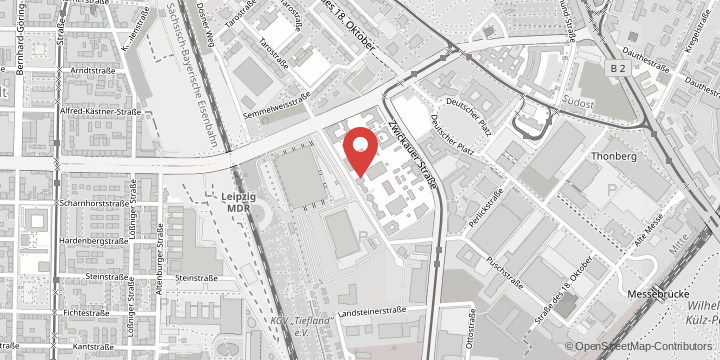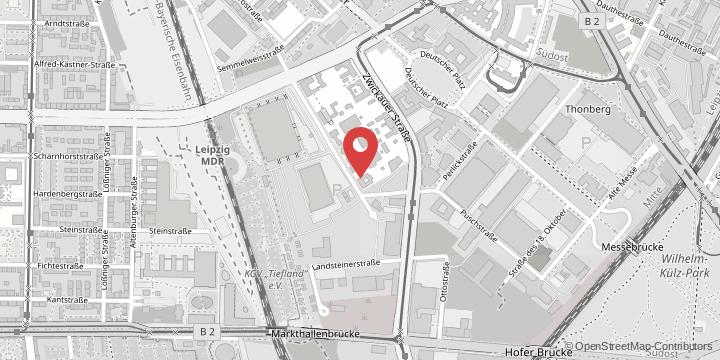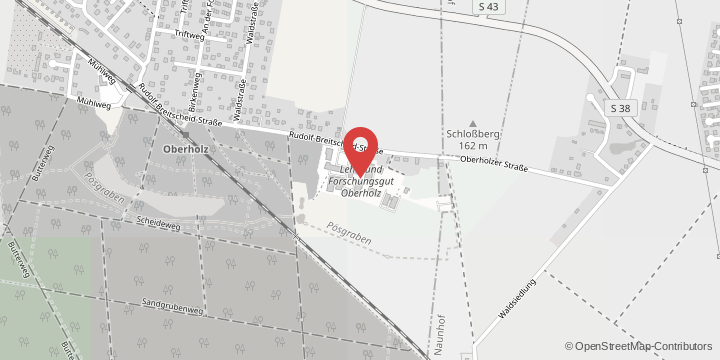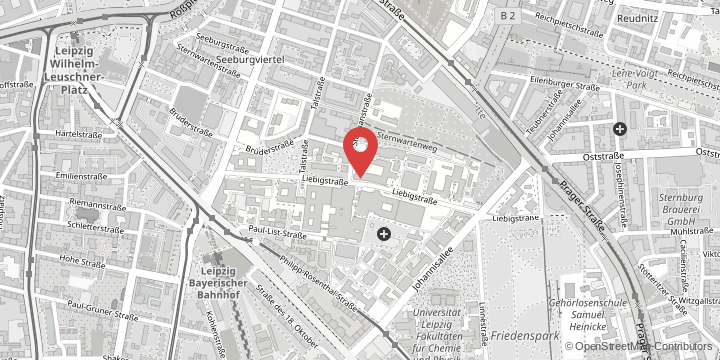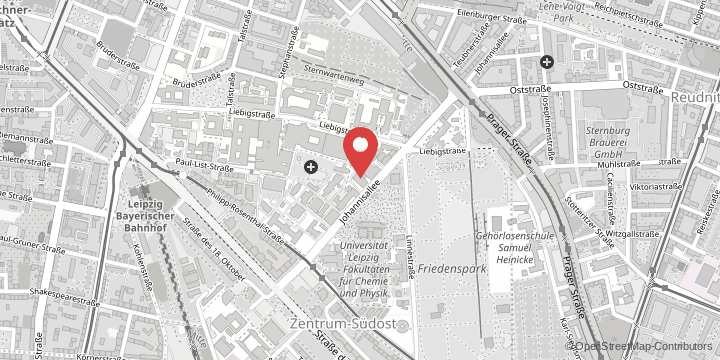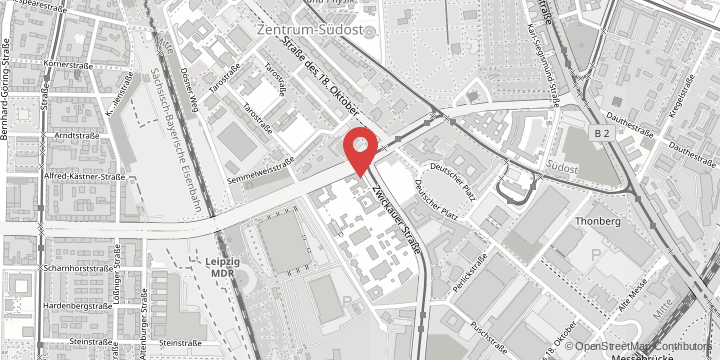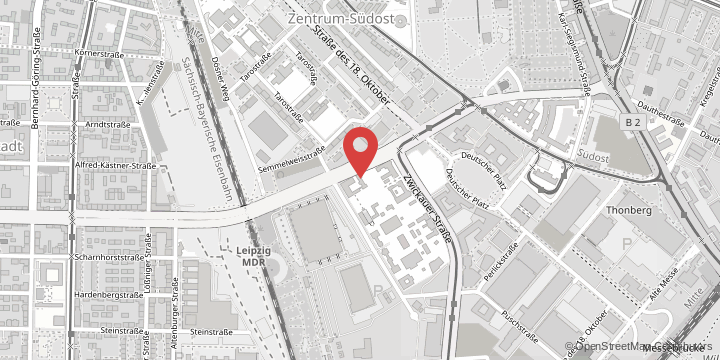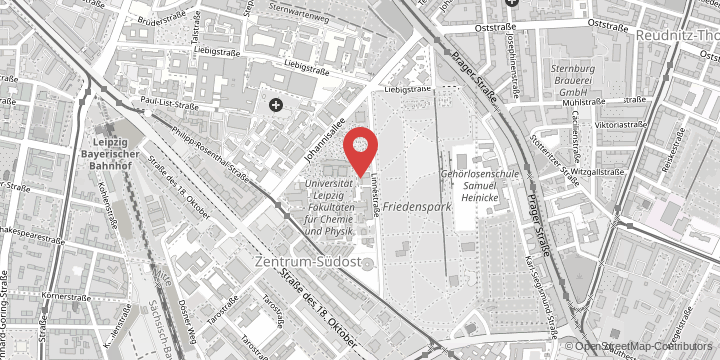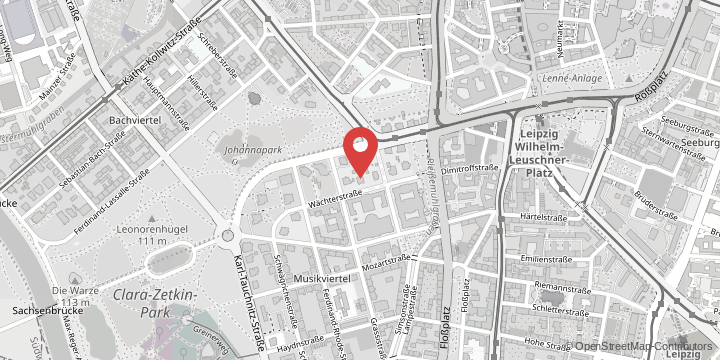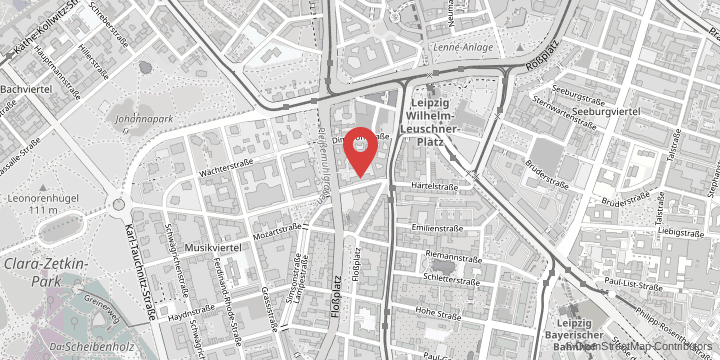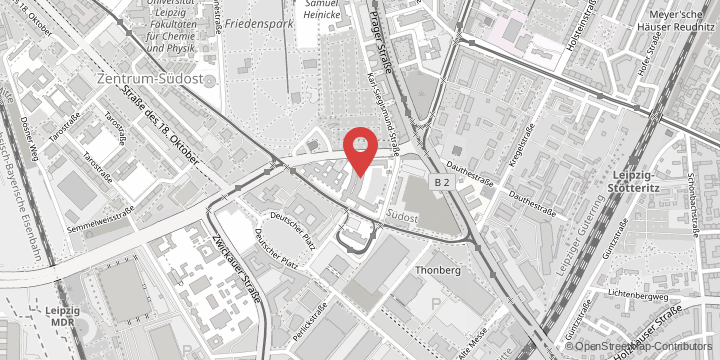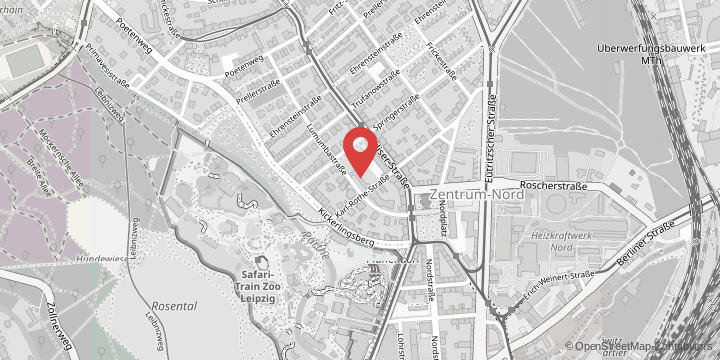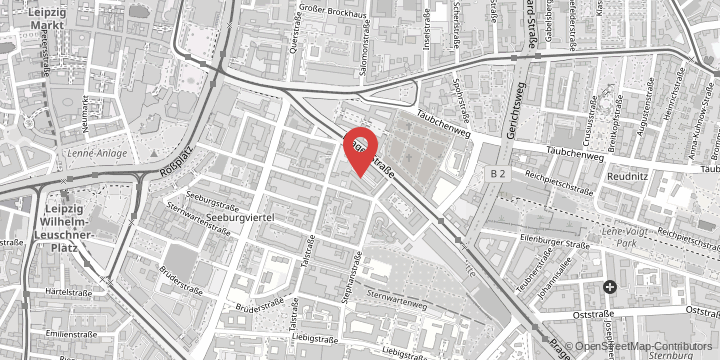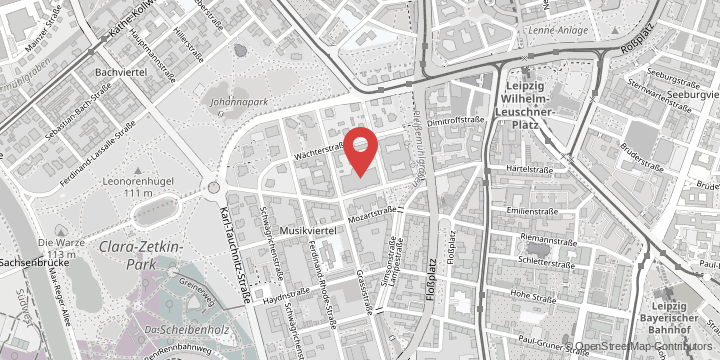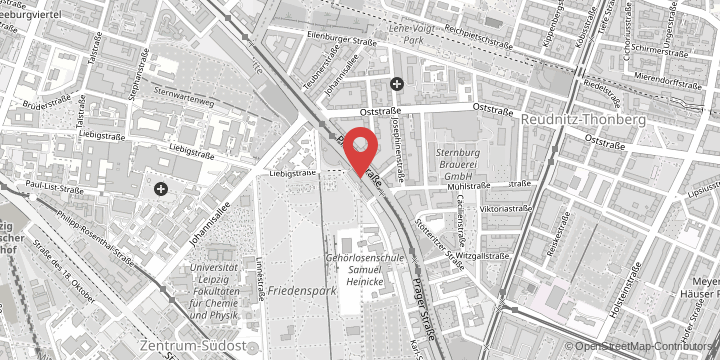In der westlichen Öffentlichkeit haben sich anscheinend zwei Lager gebildet, die sich entweder mit Israel oder mit den Palästinensern solidarisieren. Lässt sich das (auch) historisch erklären?
Prof. Dr. Dirk van Laak: Wie eigentlich fast immer, spielen Geschichte und Erinnerungskultur bei solchen Fragen eine wesentliche Rolle. Deutschland ist hier bekanntlich besonders geprägt, auch wenn sich ein umfassendes Bewusstsein in Bezug auf das Außergewöhnliche der Shoah erst seit den 1980er Jahren herausgebildet hat. Ein Wiedergutmachungsabkommen mit Israel musste in den 1950er Jahren von Bundeskanzler Konrad Adenauer noch gegen den Willen einer Mehrheit der Westdeutschen durchgesetzt werden.
In der Phase der Dekolonisation, besonders nach dem Sechstagekrieg im Jahr 1967, setzte sich in Kreisen westdeutscher Linker die These fest, Israel sei ein imperialistischer Staat und überhaupt eine Art von westlicher „Siedlungskolonie“ im arabischen Raum. Das bedingte dann eine Solidarität mit den vertriebenen und „unterdrückten“ Palästinensern. Diese kritische Auffassung gegenüber Israel war auch in der DDR eine Staatsdoktrin, bis sie sich in den späten 1980er Jahren zu lockern begann.
Seit einiger Zeit wird nun diskutiert, ob der Holocaust nicht stärker in Bezug zu anderen, etwa kolonialen Genoziden gesetzt werden sollte. Das geschieht auch, wobei die Einzigartigkeit der staatlich sanktionierten Verfolgung und systematischen Ermordung von Juden im „Dritten Reich“ bislang nicht hat erschüttert werden können. Die Diskursverläufe sind heute sehr schwer zu identifizieren und mit allem Möglichen aufgeladen, das sich mit historischer Erkenntnis nicht mehr begründen lässt.
Wie wird in Polen über das Massaker vom 7. Oktober und den Gaza-Krieg diskutiert? Gibt es Unterschiede zur Debatte in Deutschland?
Prof. Dr. Anna Artwinska: Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in Polen keine einheitliche Debatte zum Nahostkonflikt, sondern eine Vielfalt von Stimmen, Meinungen und Positionen, die quer durch die Gesellschaft gehen. Vergleicht man diese Diskussionen mit Deutschland, so wird deutlich, dass trotz vieler Unterschiede, die auf die jeweilige historische Vergangenheit zurückzuführen sind, in Polen heute ähnliche Argumentationslinien "pro Israel" bzw. "pro Palästina" verwendet werden.
Anhand des Nahostkonflikts merkt man deutlich die Globalisierung. Es sind transnationale Allianzen und Zusammenschlüsse zu beobachten, zum Beispiel unter einigen linken Gruppen, die in Israel einen „Kolonialstaat“ sehen wollen oder unter protestierenden Studierenden. Da aber die Existenz Israels in Polen keine Staatsräson wie in Deutschland ist, wird die Kritik an Israel – etwas pauschal formuliert – oft heftiger und direkter geführt.
Die Debatten über den Gaza-Krieg verschränken sich zudem mit den Debatten über Gewalt und Push-Backs an der polnisch-belarussischen Grenze, wobei nicht historisch, sondern aus der Perspektive von Menschenrechtsverletzungen argumentiert wird. Andererseits ist Polen ein Land, in dem vor dem Zweiten Weltkrieg rund 3,4 Millionen Jüdinnen und Juden lebten; viele Israelis haben polnische Wurzeln. Dies bleibt nicht ohne Einfluss auf die Perspektive, aus der – natürlich wiederum nur in bestimmten Kreisen – auf den Konflikt geschaut wird.
Inwieweit prägt in Osteuropa der Holocaust den Blick auf den Nahost-Konflikt?
Artwinska: In den Kulturen Ost- und Ostmitteleuropas findet im 21. Jahrhundert eine intensive Aufarbeitung des Holocaust statt. Dabei stellt sich heraus, dass zum Beispiel die polnische Gesellschaft, die sich gerne mit der Rolle der Gerechtesten unter den Völkern identifiziert, während des Holocaust auch als Mittäter agierte. Spätestens seit der Veröffentlichung von Jan Tomasz Gross' „Nachbarn. Der Mord an den Juden von Jedwabne“ (2001) ist klar, dass sich die polnische Gesellschaft auch mit ihrer eigenen Geschichte der Kollaboration und Auslieferung von Juden an die Nationalsozialisten auseinandersetzen muss. Dies bleibt jedoch eine unbequeme Wahrheit, die viele nicht wahrhaben wollen.
Der Nahost-Konflikt hat den latenten polnischen Antisemitismus leider wieder entfacht. Ich beobachte antisemitische Äußerungen sowohl von der politischen ,Rechten‘ als auch von der ,Linken‘, sowohl in den Mainstream-Zeitungen als auch in den sozialen Medien. Das soll nicht heißen, dass alle Polen antisemitisch sind, aber eine nicht aufgearbeitete Geschichte des Antisemitismus kann dazu führen, dass judenfeindliche Äußerungen leichter und ungestraft weitergegeben werden.
In Tschechien ist die Situation wiederum anders, da die meisten Jüdinnen und Juden vor 1939 deutschsprachig und stärker in die tschechischsprachige Gesellschaft integriert waren. Einen Antisemitismus gab es in Tschechien natürlich auch, aber in einem anderen Ausmaß als in Polen. Aus diesem Grund prägt der Holocaust in Tschechien weniger die Wahrnehmung des Nahostkonflikts. Bei der Abstimmung über die US-Resolution im Herbst 2023 zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen stimmte Tschechien übrigens mit „Nein“.