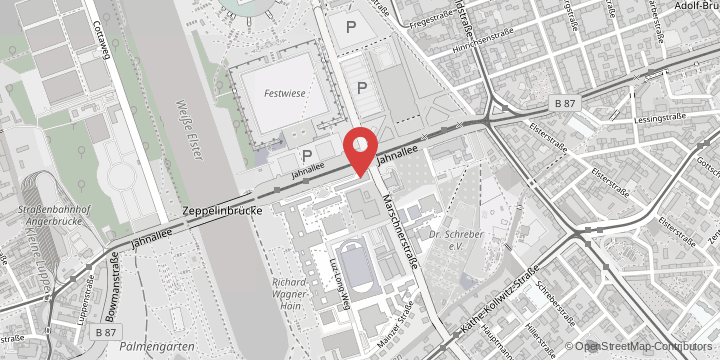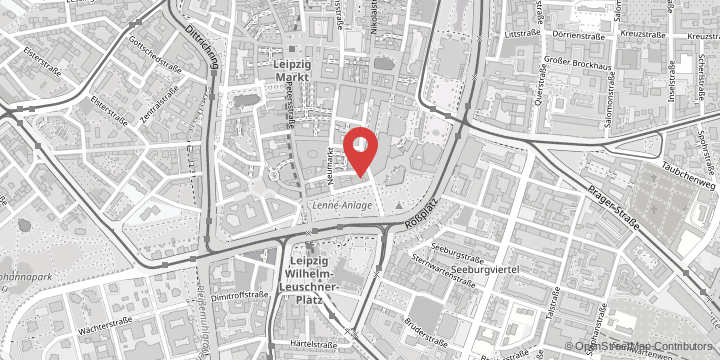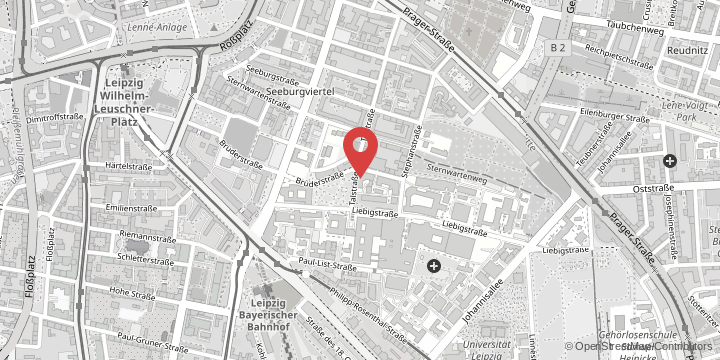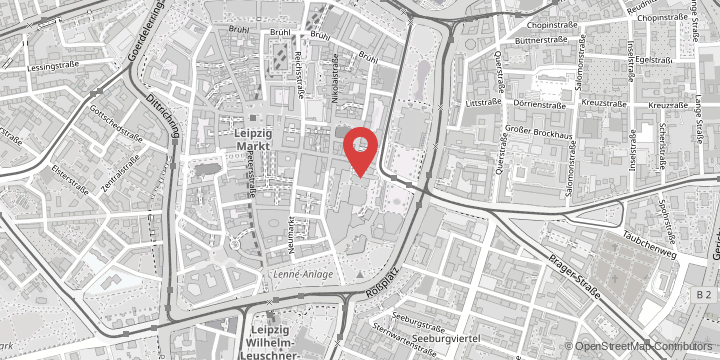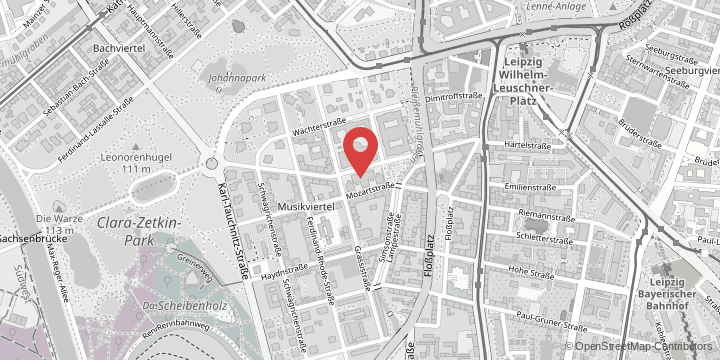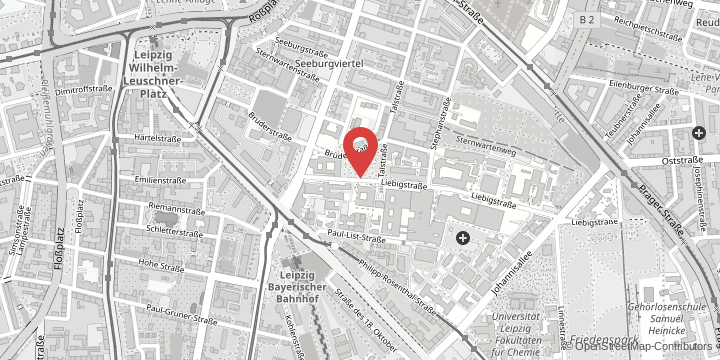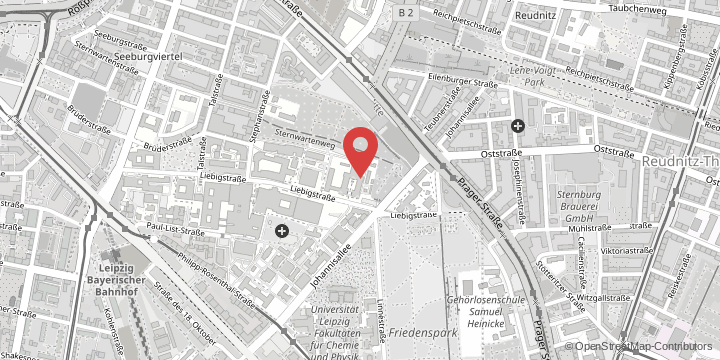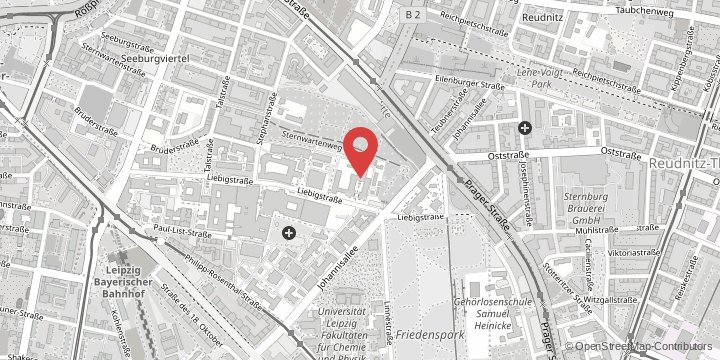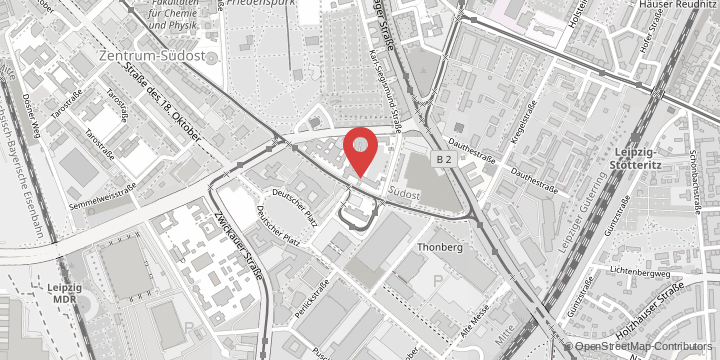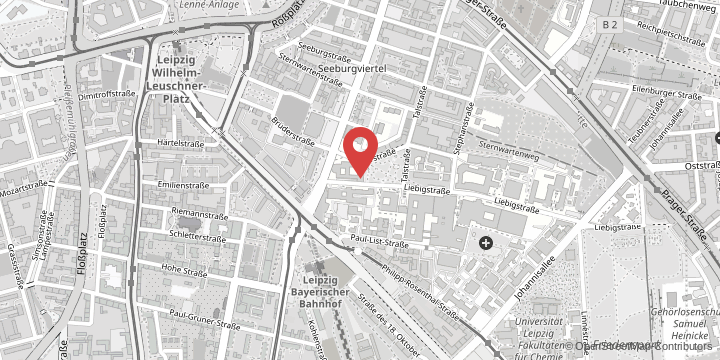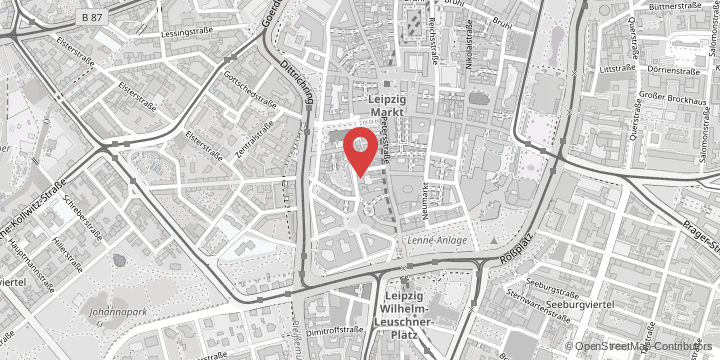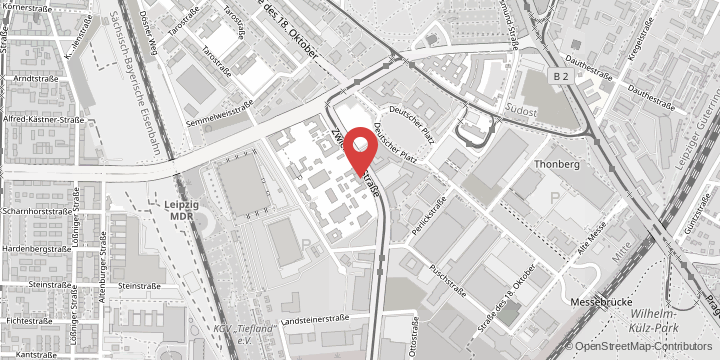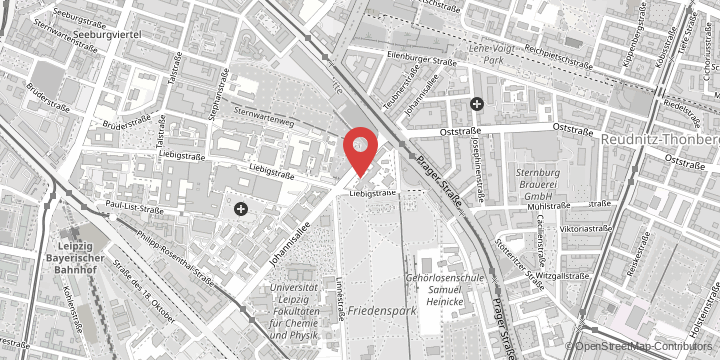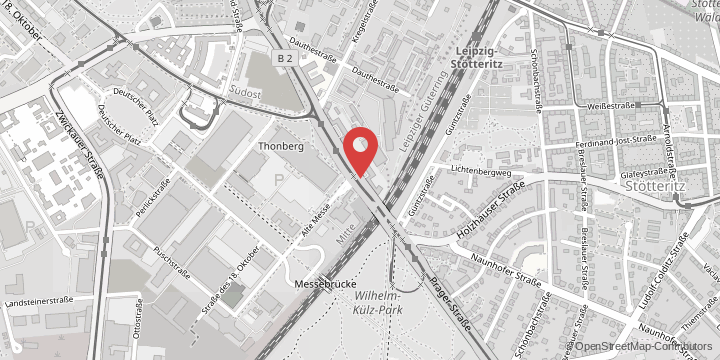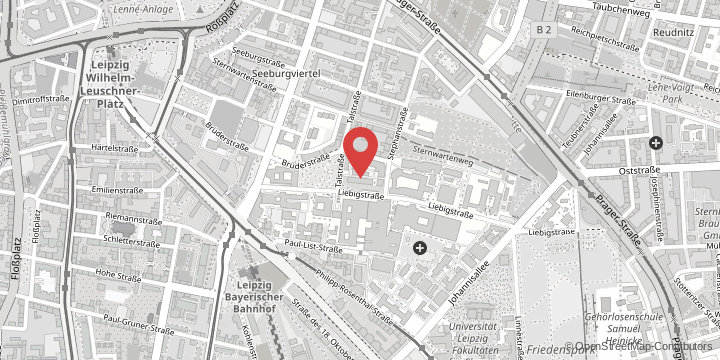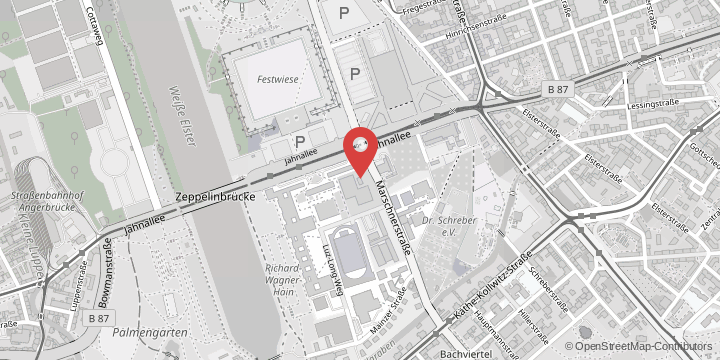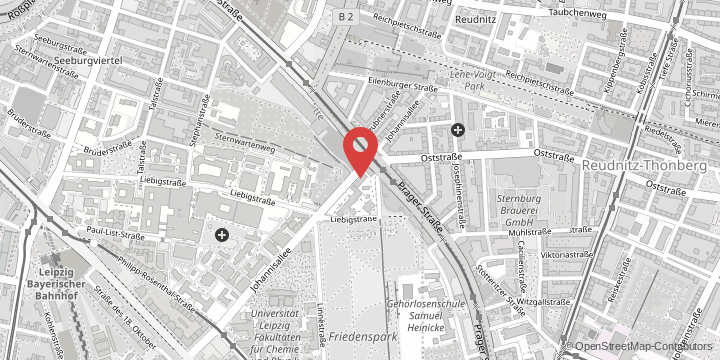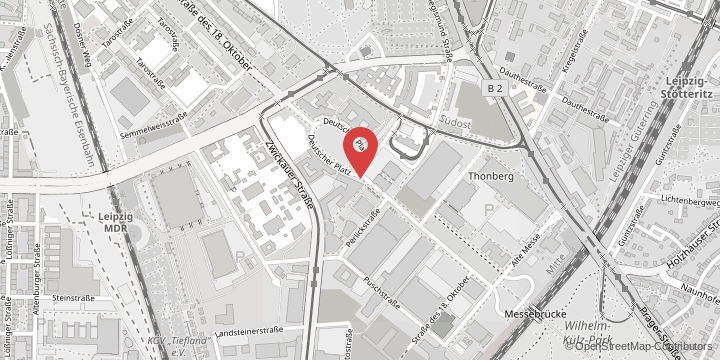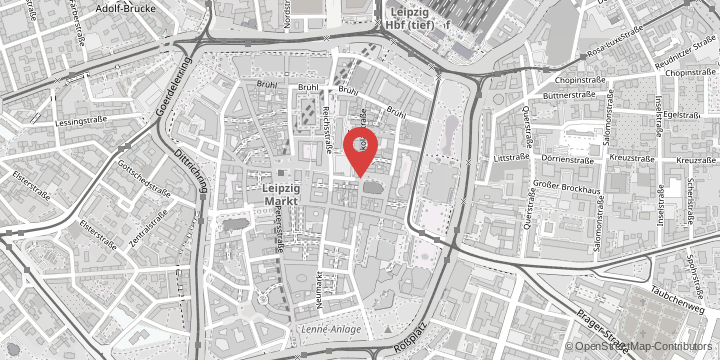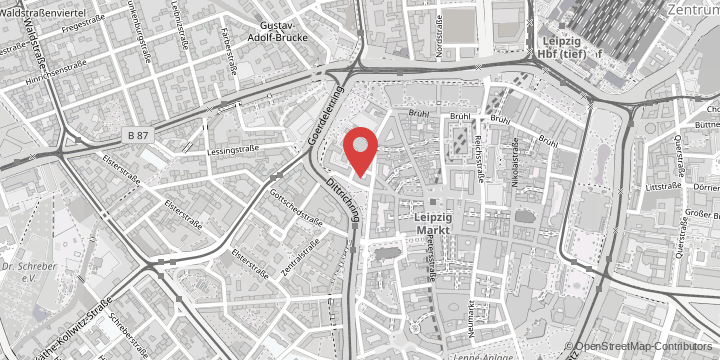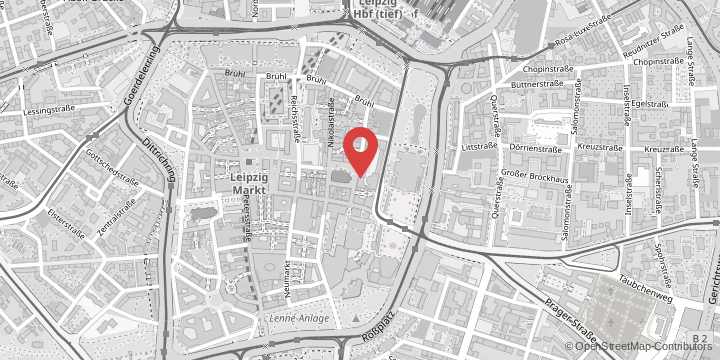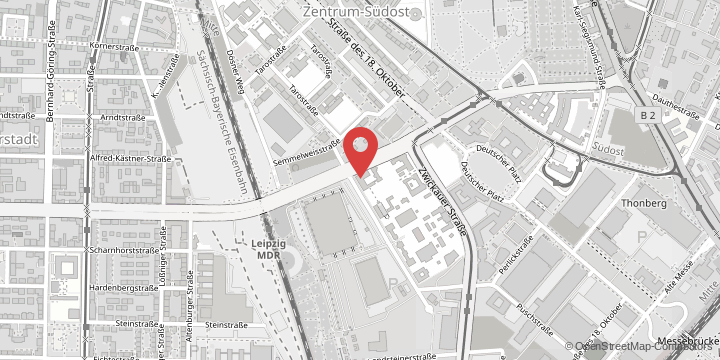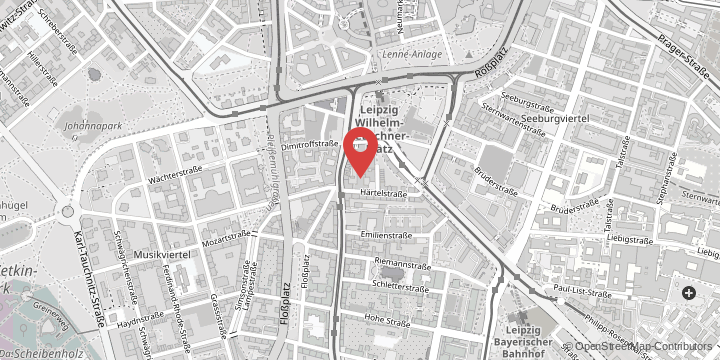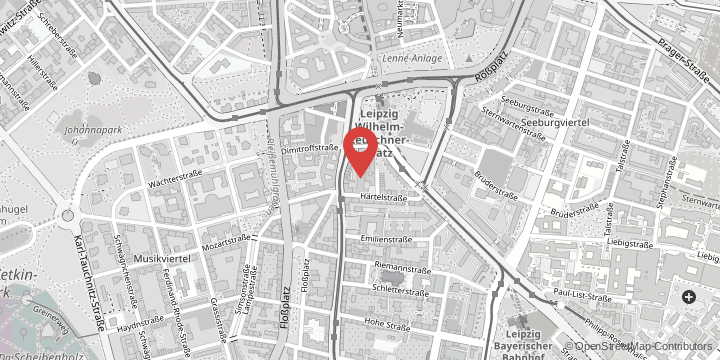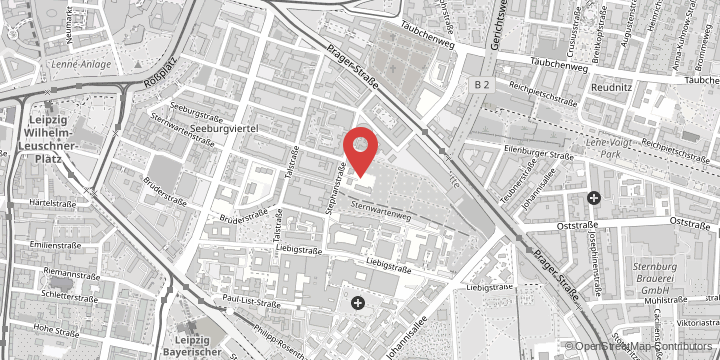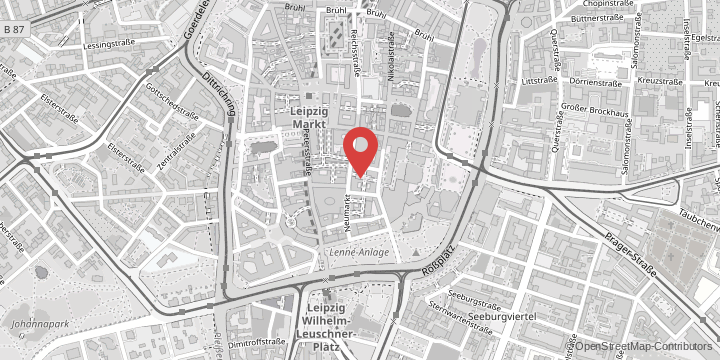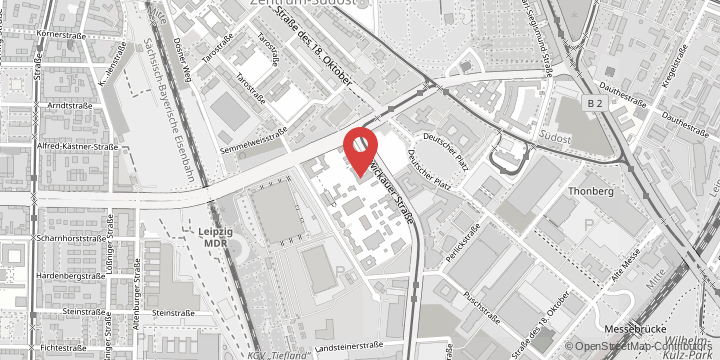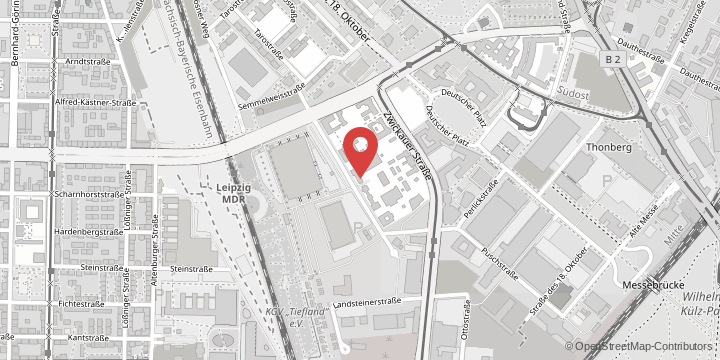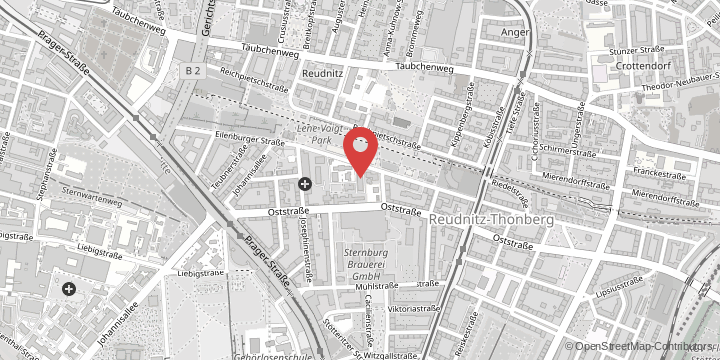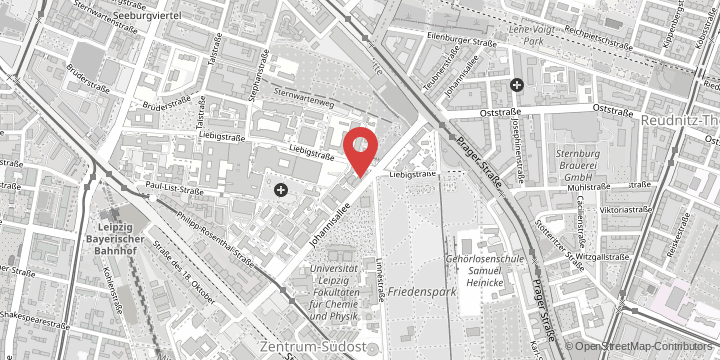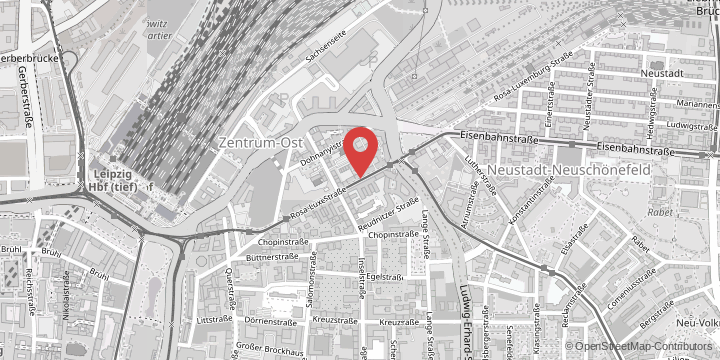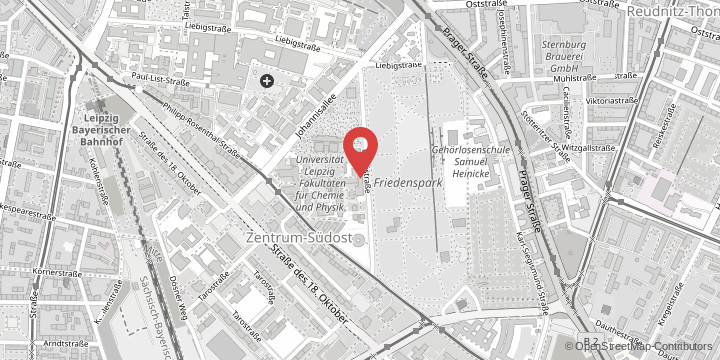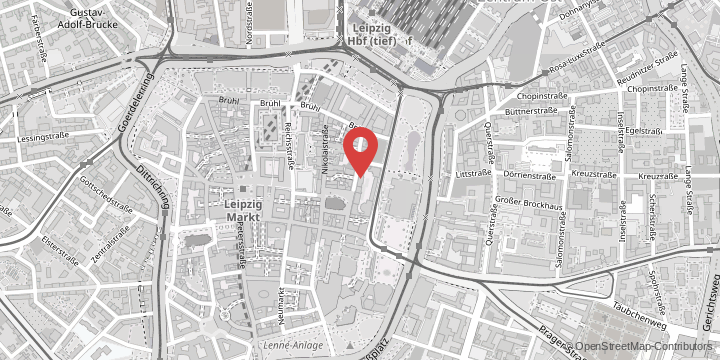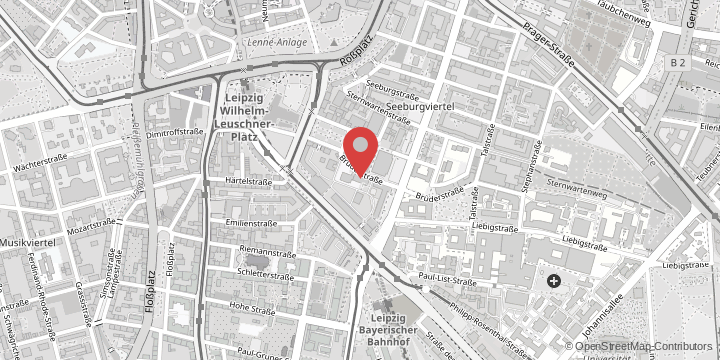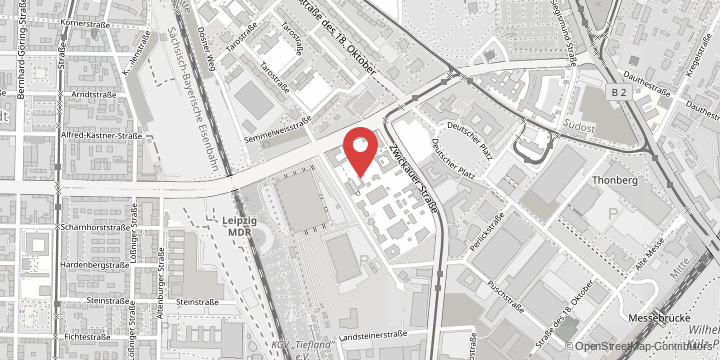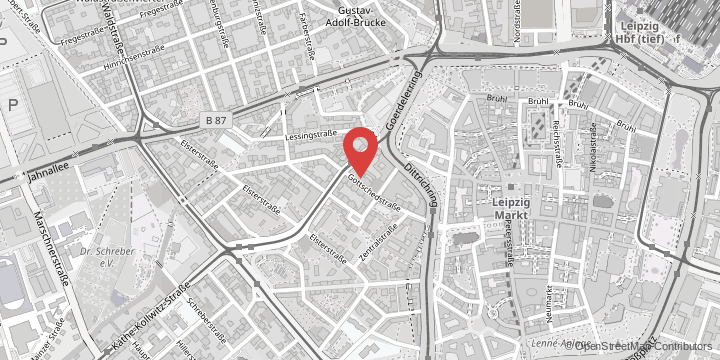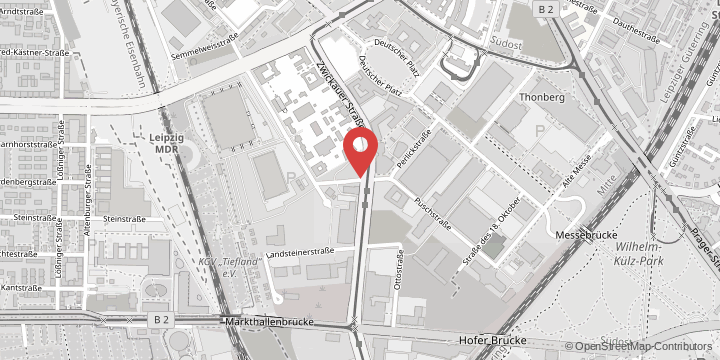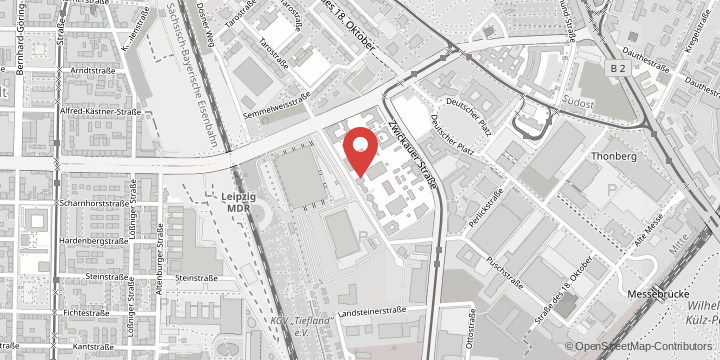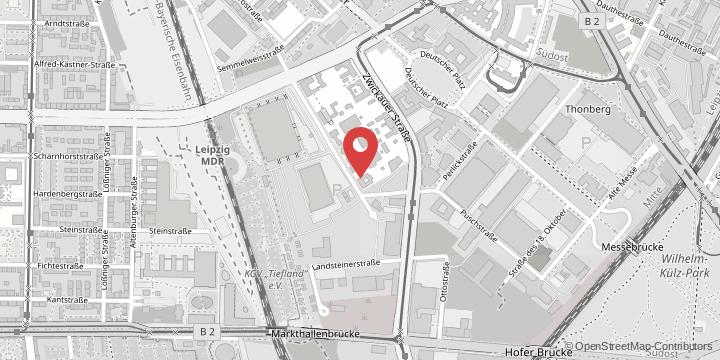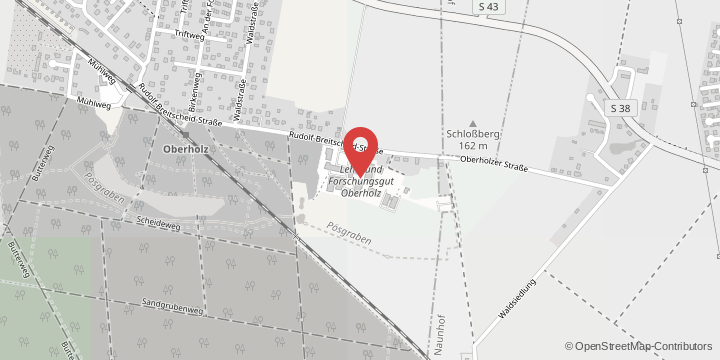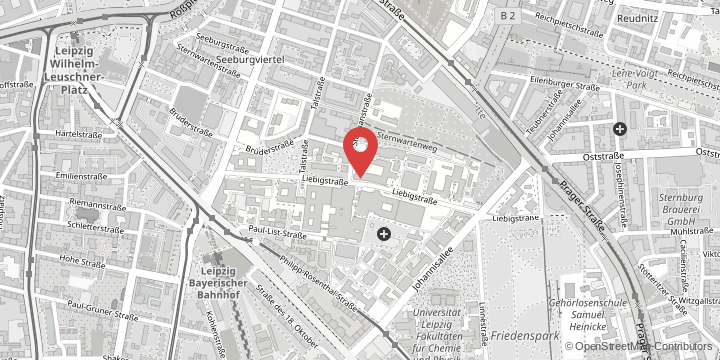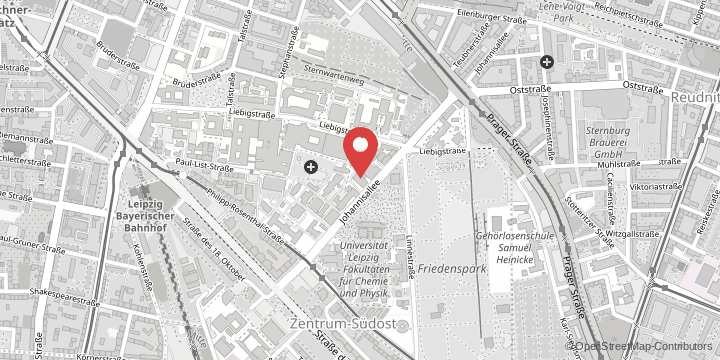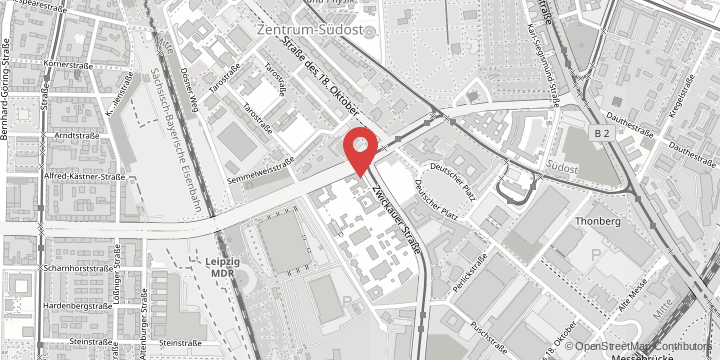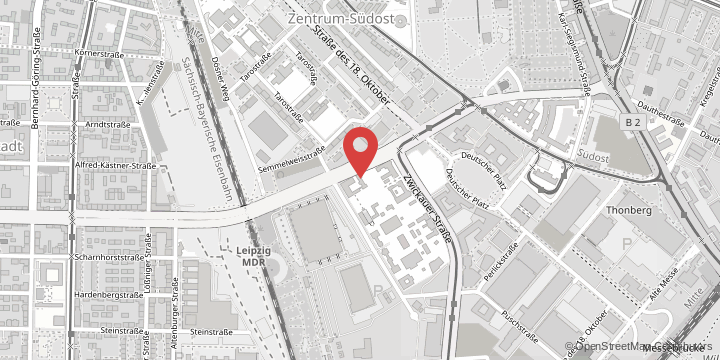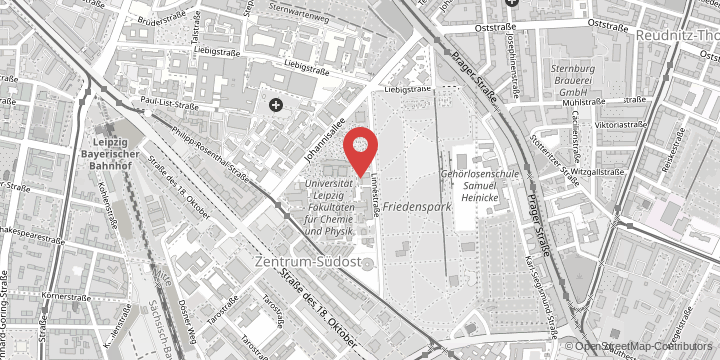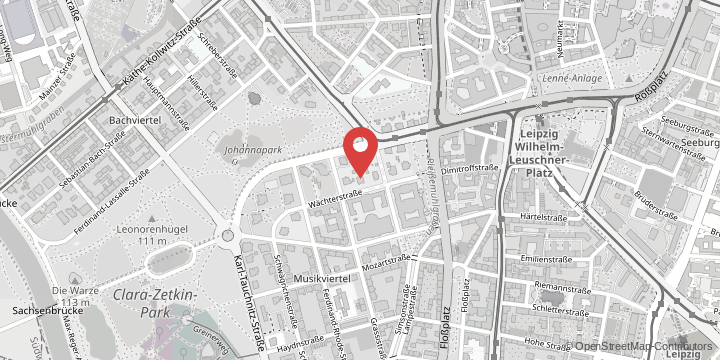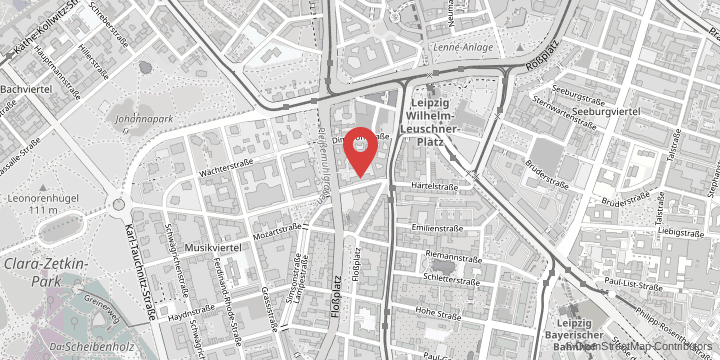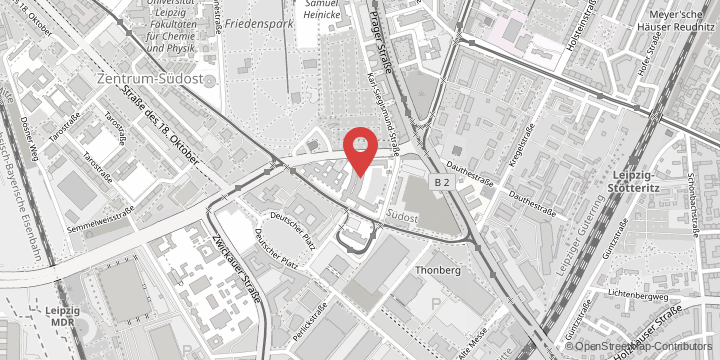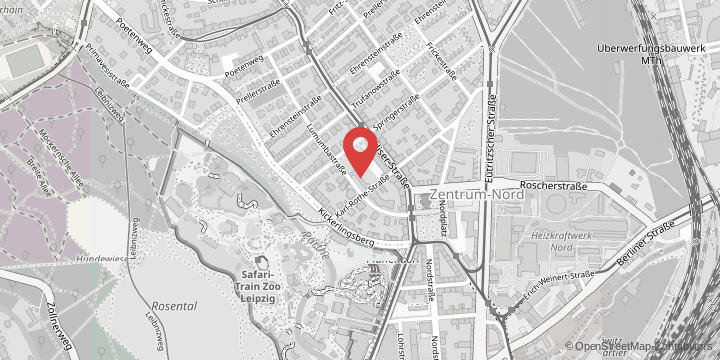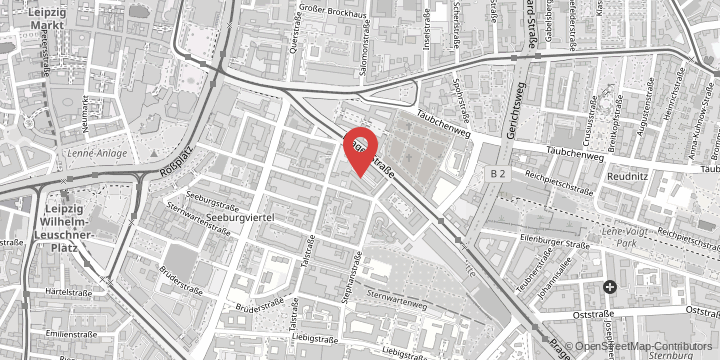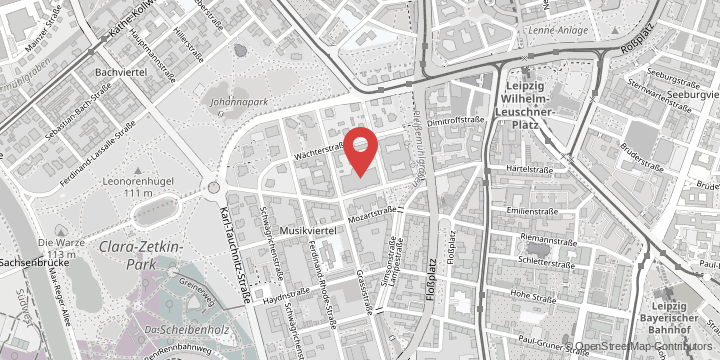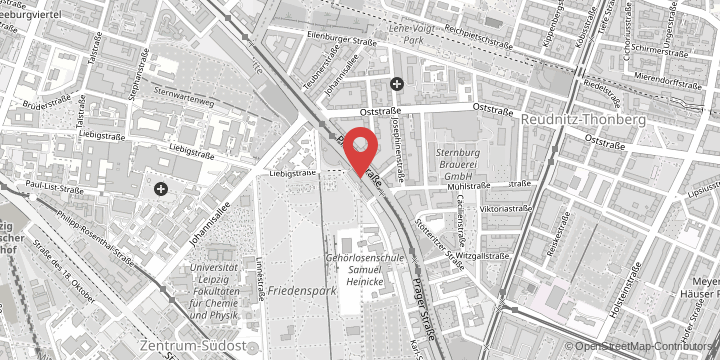„Fußball verbindet uns.“ Mit dieser Aussage aus dem Jugendroman „Mandela und Nelson“ von Hermann Schulz soll auf das interkulturelle Potenzial von Fußball hingewiesen werden. Inszeniert werden in diesem Roman „bunte“ Mannschaften, wie sie heute in den meisten großen europäischen Fußballvereinen zu finden sind. Auf der einen Seite steht eine tansanische Mannschaft, die aus Mädchen und Jungen aus armen und reichen Elternhäusern sowie aus unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und Volksgruppen besteht. In dem Roman befähigt diese Vielfalt das Team, Diskriminierungen entschieden zu begegnen. Der tansanischen Elf gegenüber steht eine fiktive deutsche Jungenmannschaft aus Jugendlichen unterschiedlicher Haut- und Haarfarben, darunter auch fünf Schwarze Spieler. Schwarze Fußballspieler:innen, so der tansanische Trainer im Roman, seien inzwischen sehr angesehen in Deutschland. Diese Umkehrung der Narrative soll den Blick auf den Anti-Schwarzen Rassismus im Fußballbereich lenken.
Nun von der Fiktion zur Realität: Am 21. Juni 2023 verschossen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam beim Auftaktspiel zur Europameisterschaft der deutschen U-21-Fußballnationalmannschaft der Männer jeweils einen Elfmeter. Moukoko berichtete anschließend von massiven rassistischen Beleidigungen gegen beide Spieler: „Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche. Wenn wir verlieren, kommen diese Affen-Kommentare. Jessic hat sie bekommen, ich habe sie bekommen. Solche Dinge gehören einfach nicht zum Fußball.“ Die explizite Unterscheidung zwischen dem gewinnenden „Wir“ (eingerahmt in „sind… alle Deutsche“) und dem verlierenden „Wir“, das mit dem rassistischen Bild des Affen gekoppelt wird, deutet darauf hin, dass Rassismus im deutschen Fußball wie auch in anderen Ländern ein strukturelles Problem bleibt, das in Momenten wie Elfmetersituationen deutlich zum Vorschein kommt.
„United by Football“ – Fußball und Zusammenhalt
Dass Fußball gesellschaftlichen Zusammenhalt stiften kann, ist nicht zu leugnen. Wenn die Nationalmannschaft spielt, sitzen Fans aus allen Teilen des Landes und weltweit vor dem Fernseher und sehnen sich Tore für ihre Mannschaft herbei – egal, wer sie schießt – oder beten für den Sieg – egal, wer die Mannschaft zum Sieg führt. Das Publikum ist bunt und multikulturell. Während Rassismus im Alltag vieler allgegenwärtig ist, ist es beim gemeinsamen Fußballschauen auf einmal egal, wie jemand aussieht, woher jemand kommt, welcher Religion er oder sie angehört, ob er oder sie Hunger leidet, diskriminiert wird oder Privilegien genießt. Im Grunde spielen nur noch die Augen eine Rolle: zum Anschauen des Spiels. Welche Farbe diese Augen haben, ist für den Genuss, Fußball zu schauen, unerheblich. Selbst mit geschlossenen Augen bleibt das Fußballspiel ein sinnliches Erlebnis: der Jubel, das Raunen, das Trommeln, das Klatschen, das Singen. Wenn Tore geschossen werden, jubeln alle und wenn es zu einer Niederlage kommt, ist die Enttäuschung groß. Die verzaubernde und verbindende Kraft von Fußball kann Differenzen überbrücken und den Eindruck vermitteln, alles sei gut. Und so wird auch Fußball instrumentalisiert, wenn man den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ländern betonen möchte, in denen dieser Begriff oft nur Schein ist.