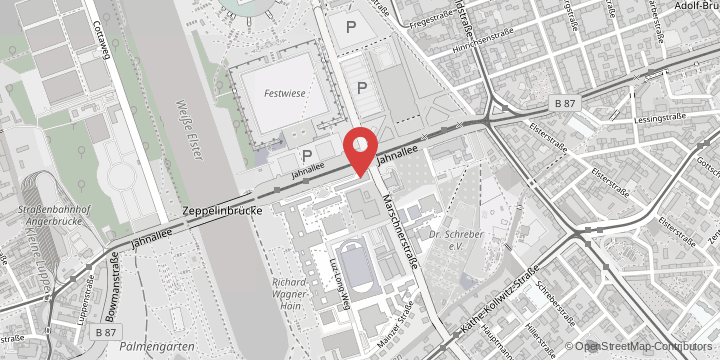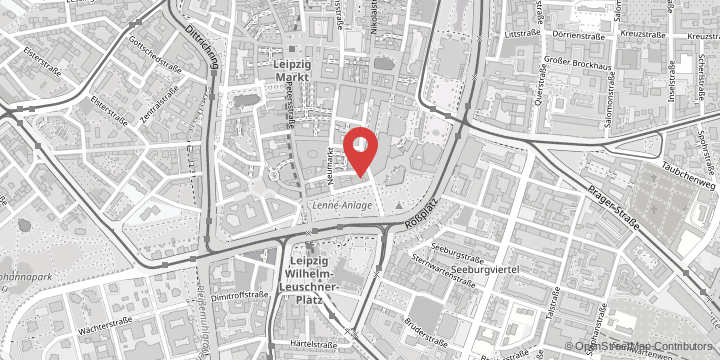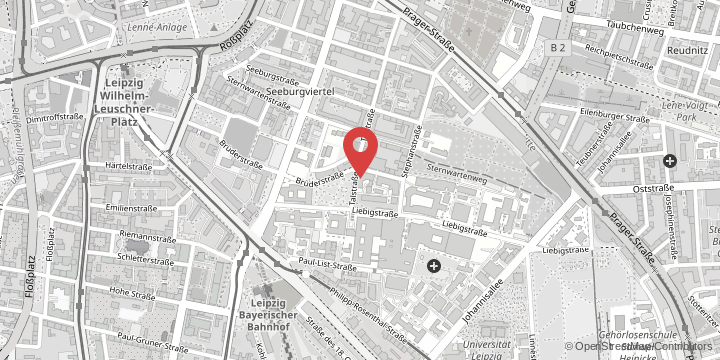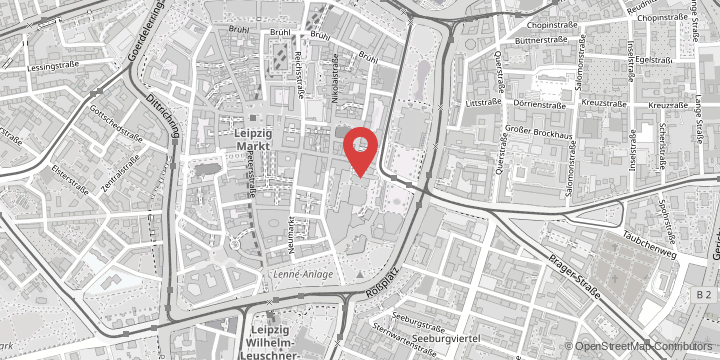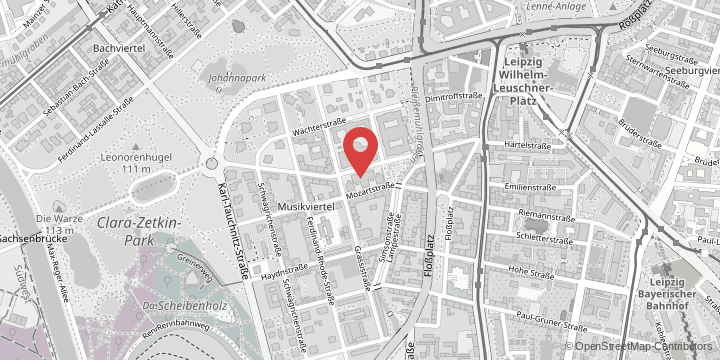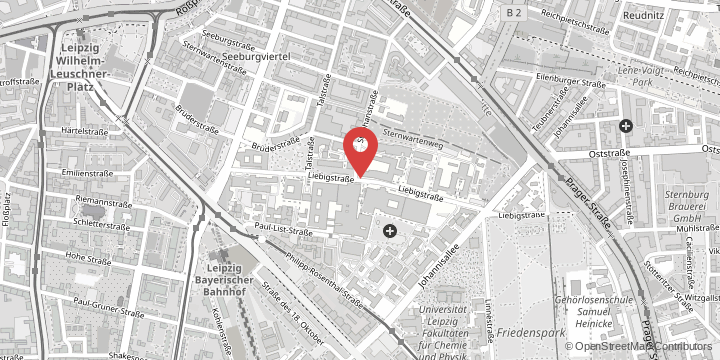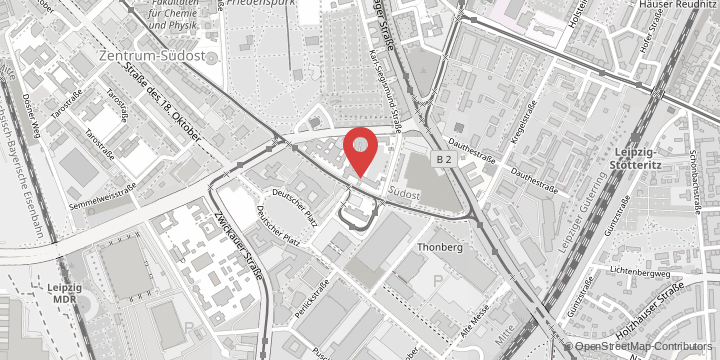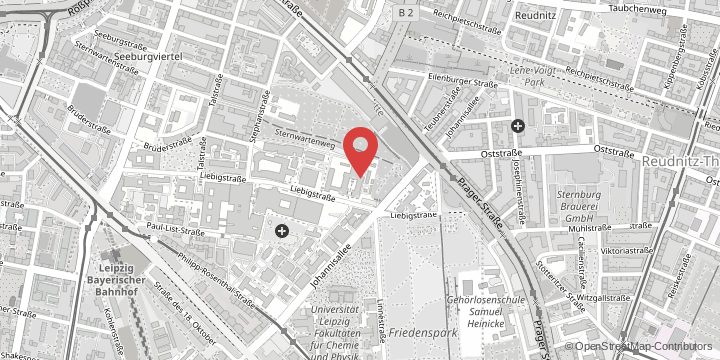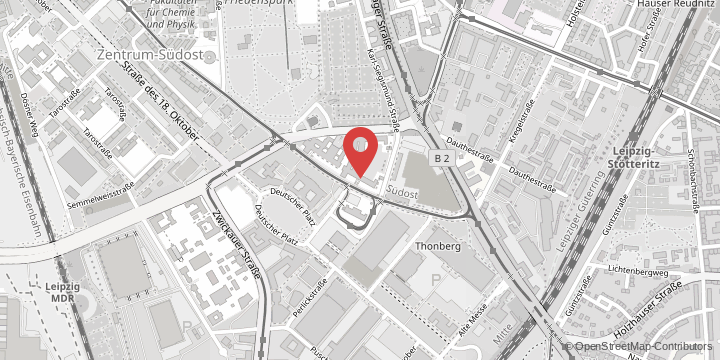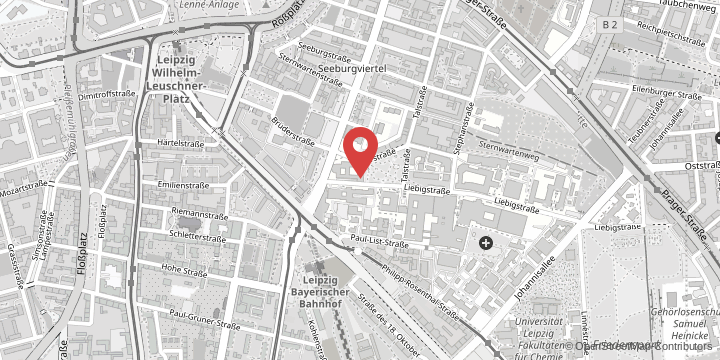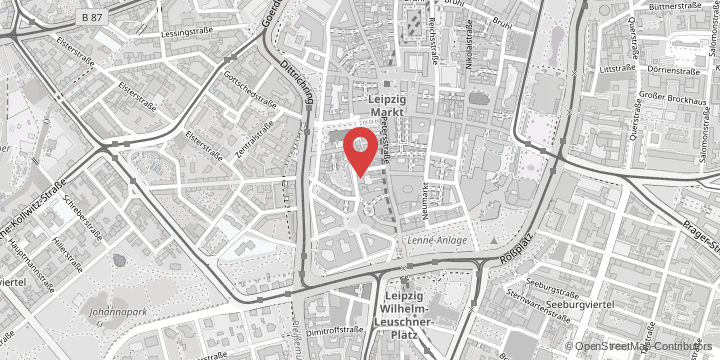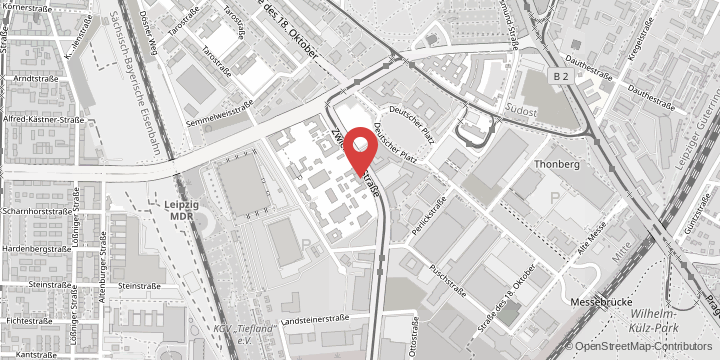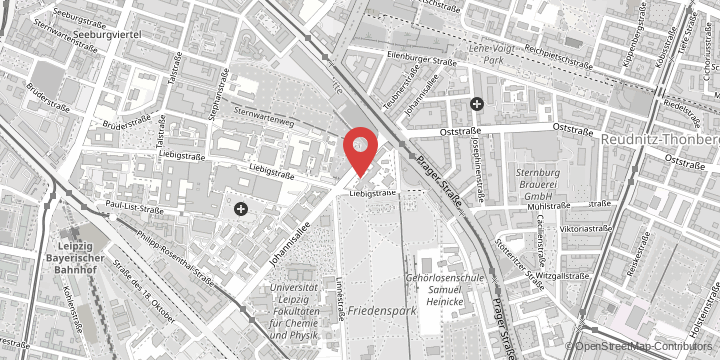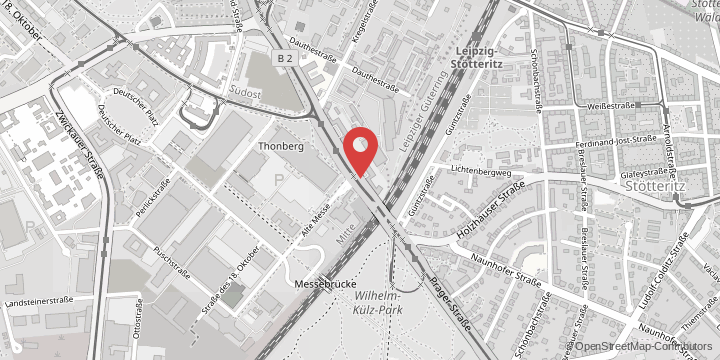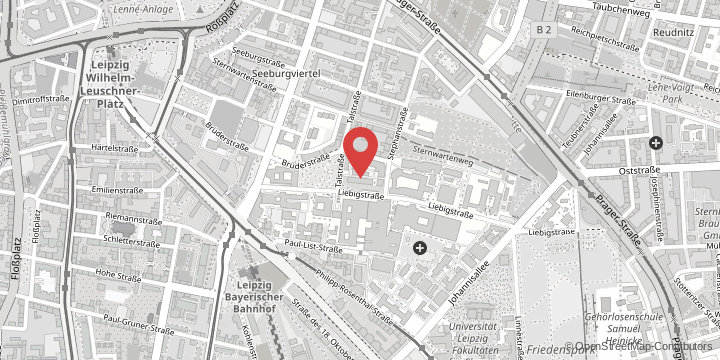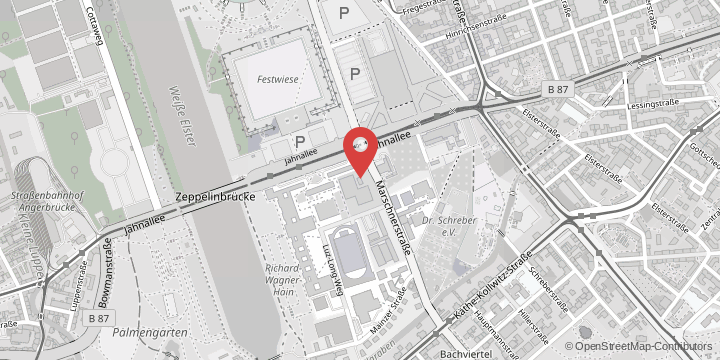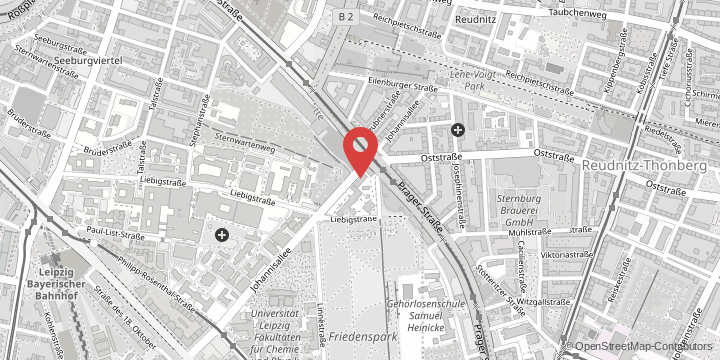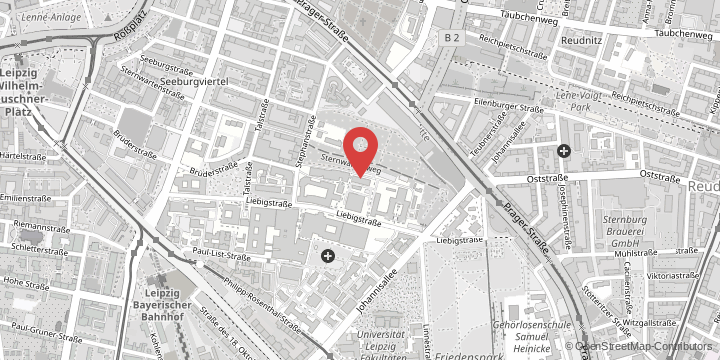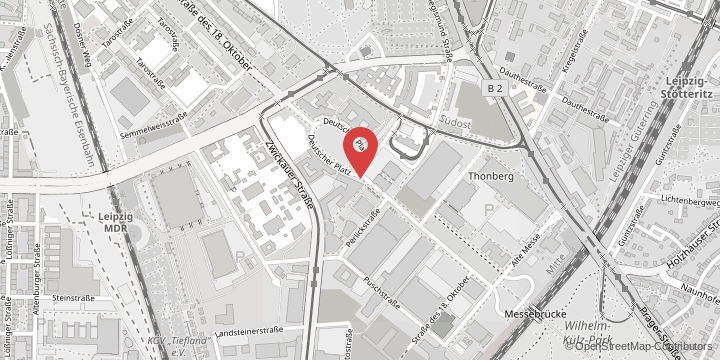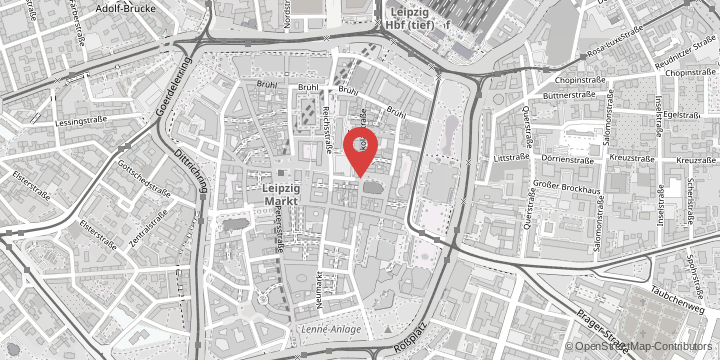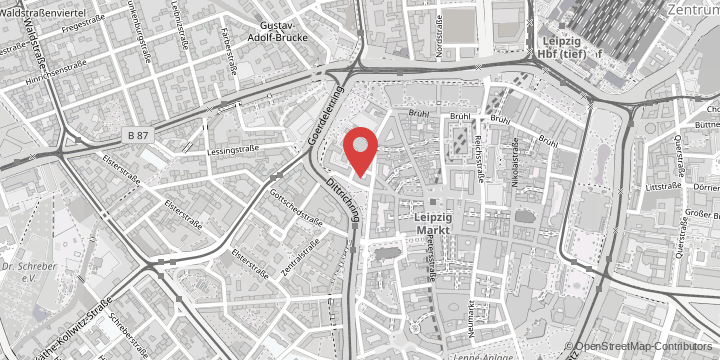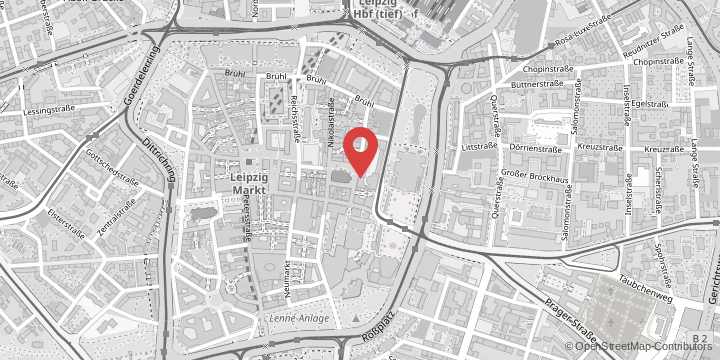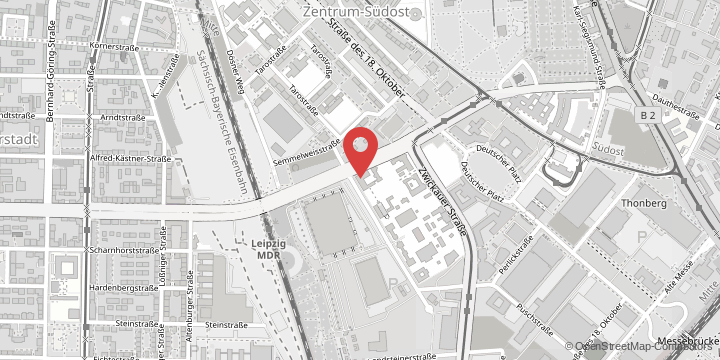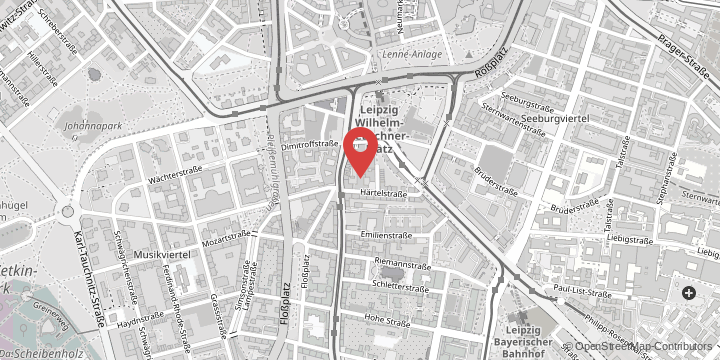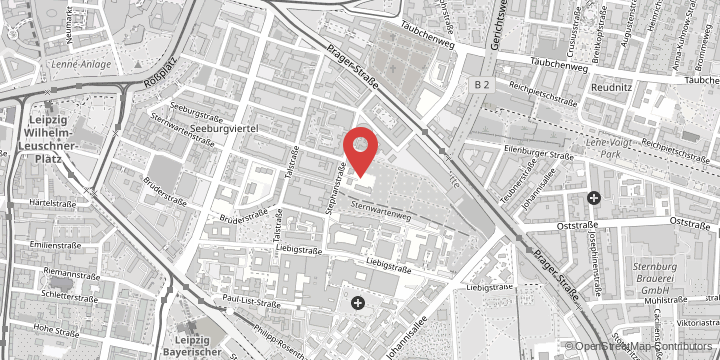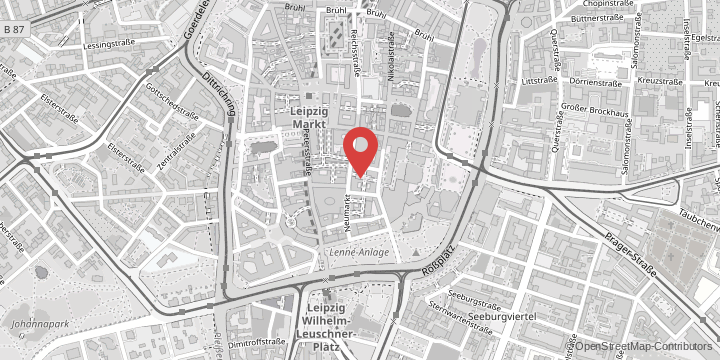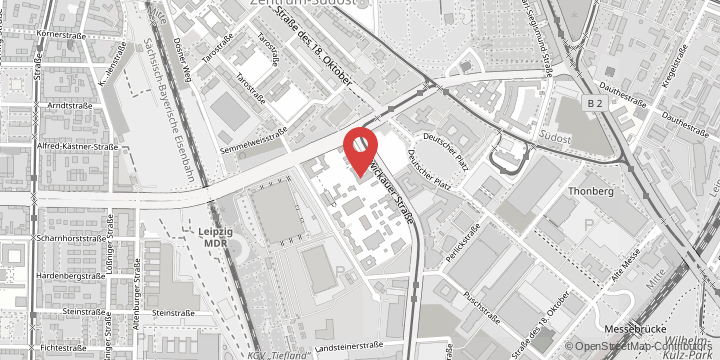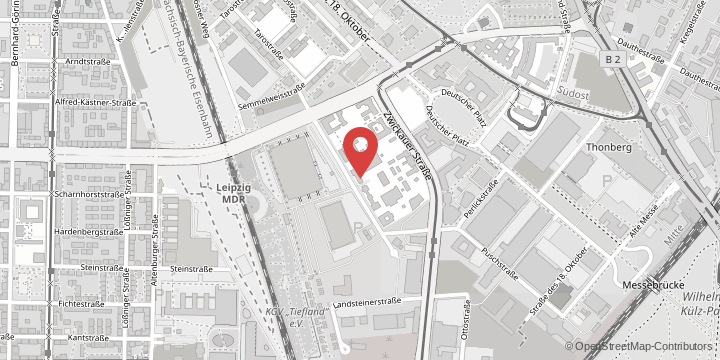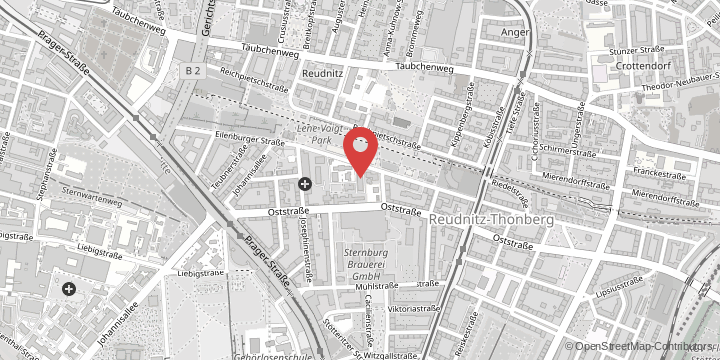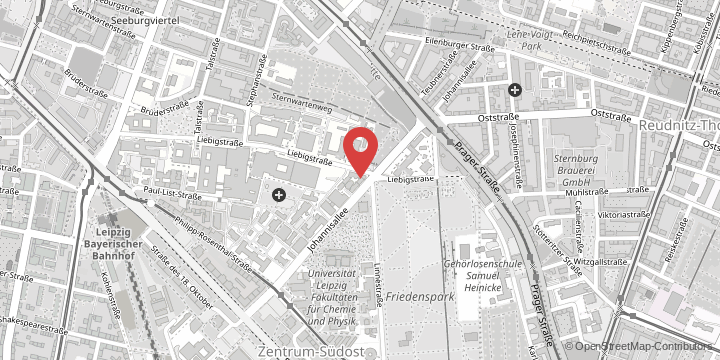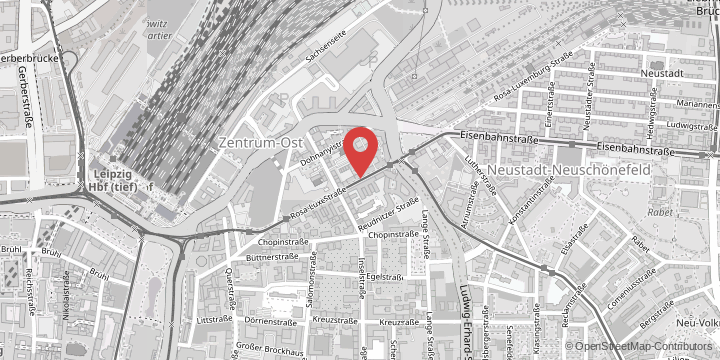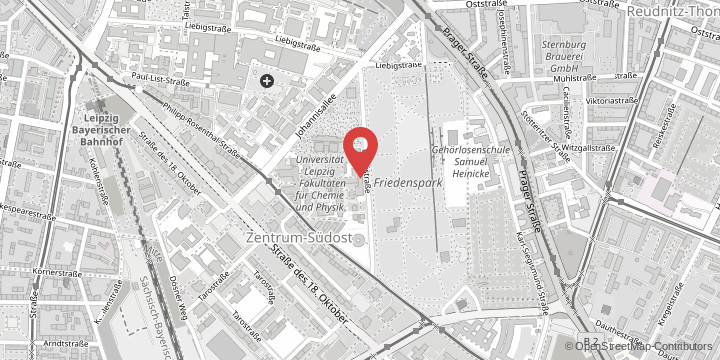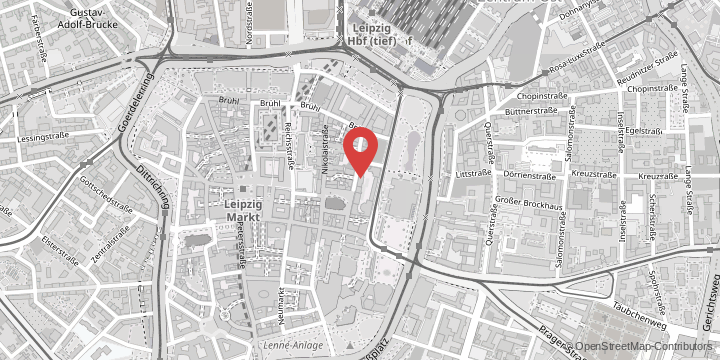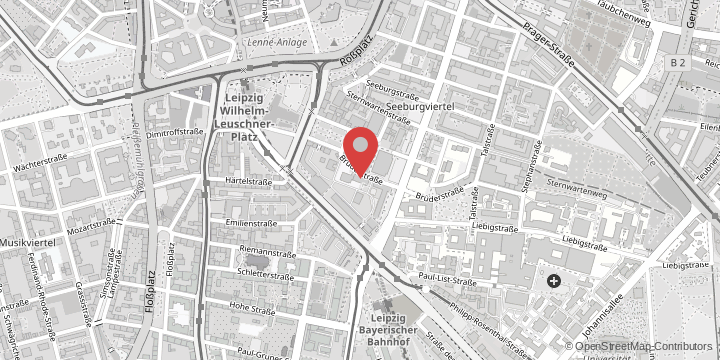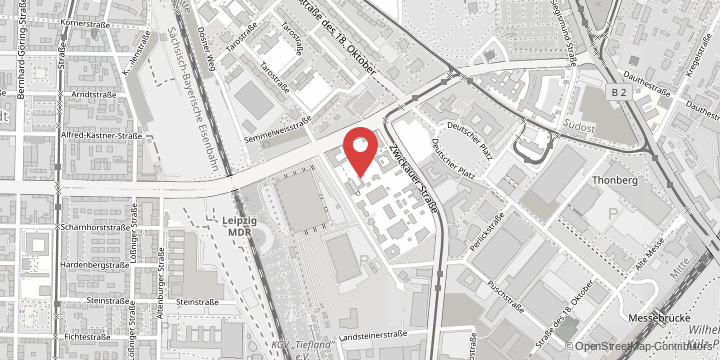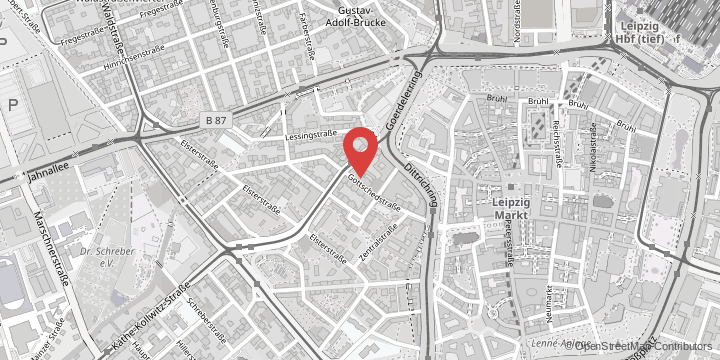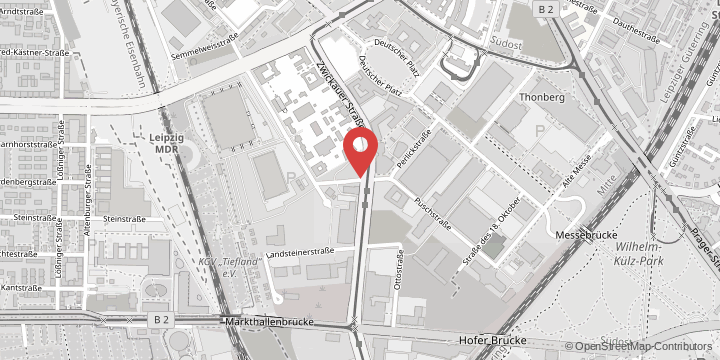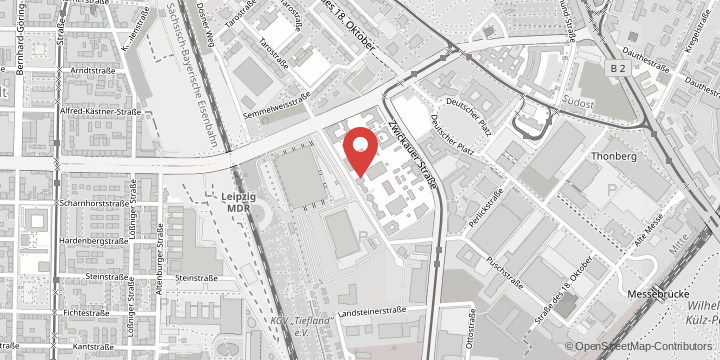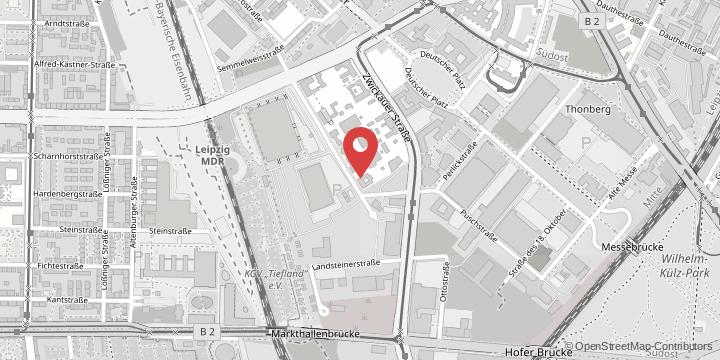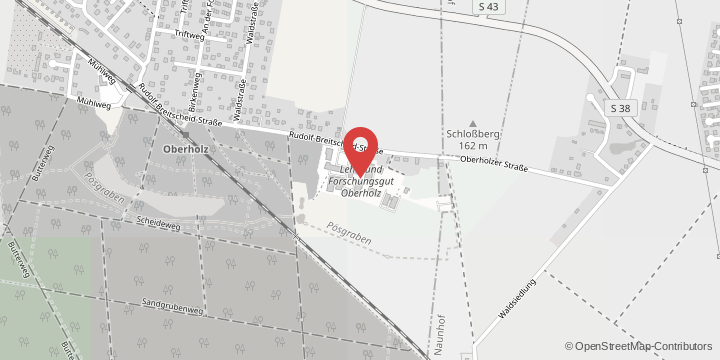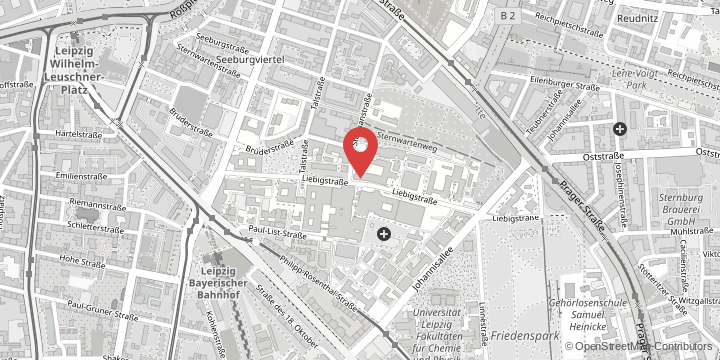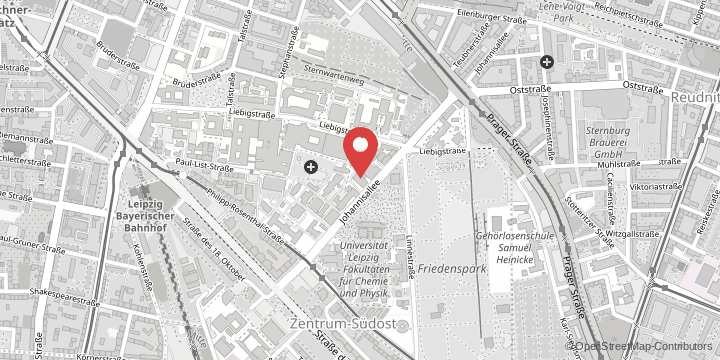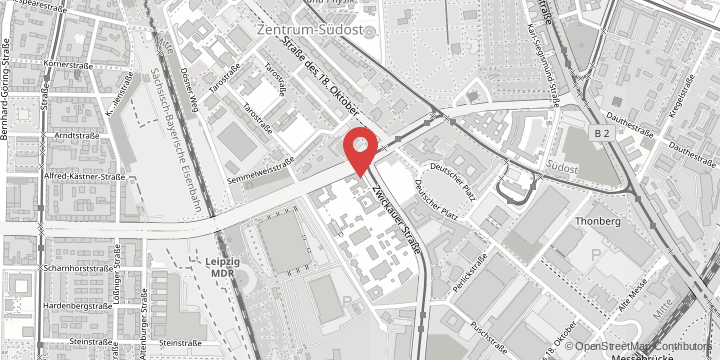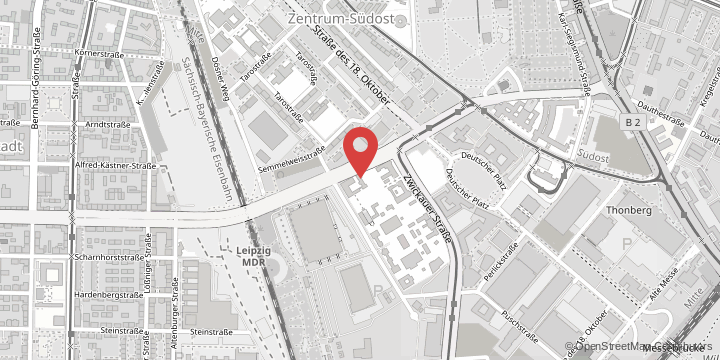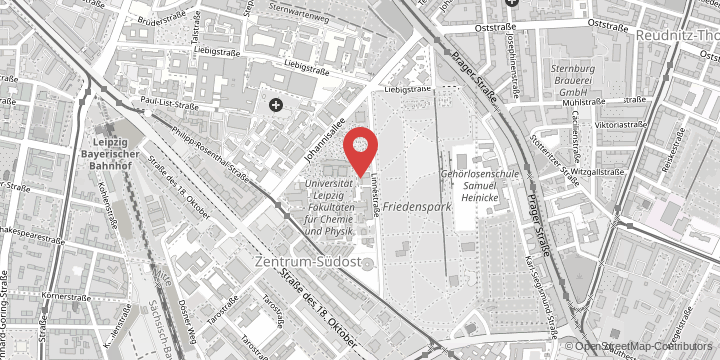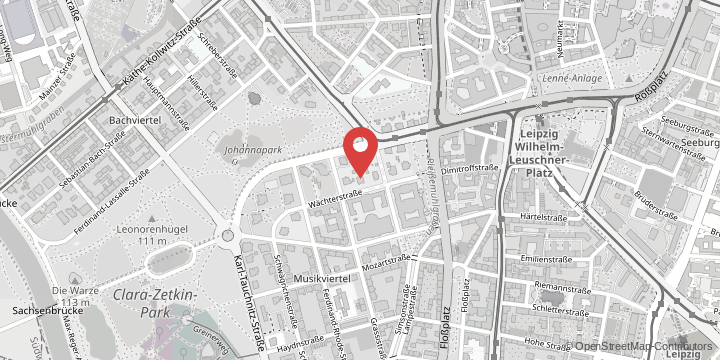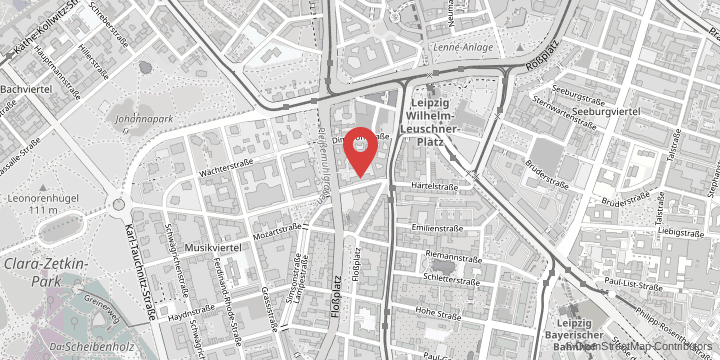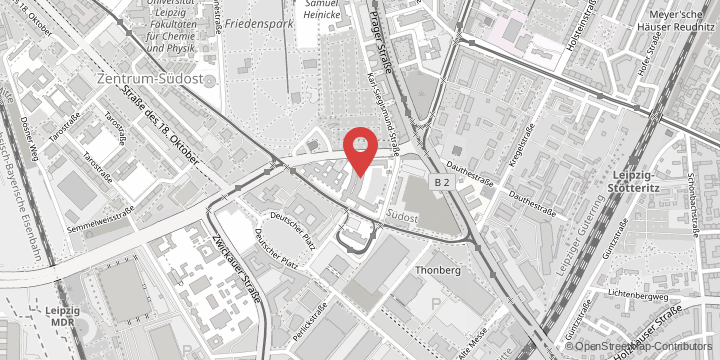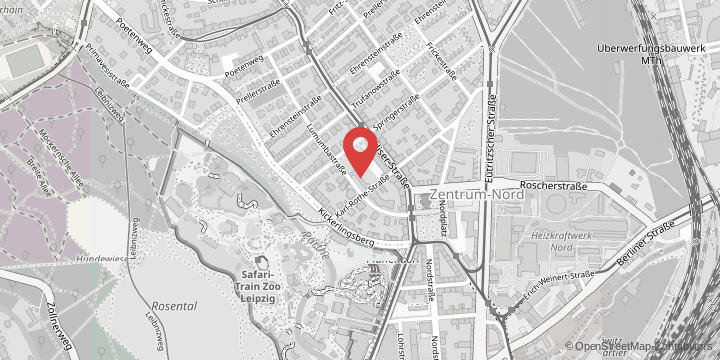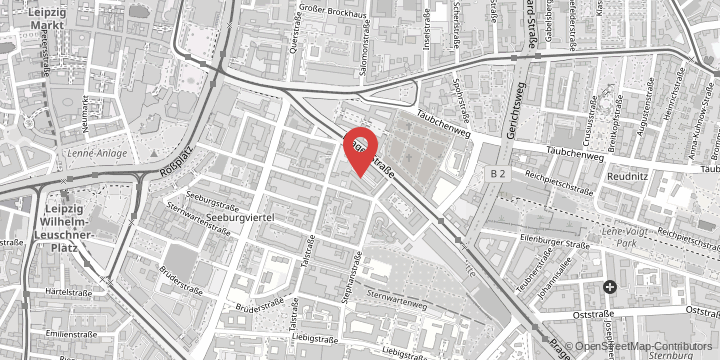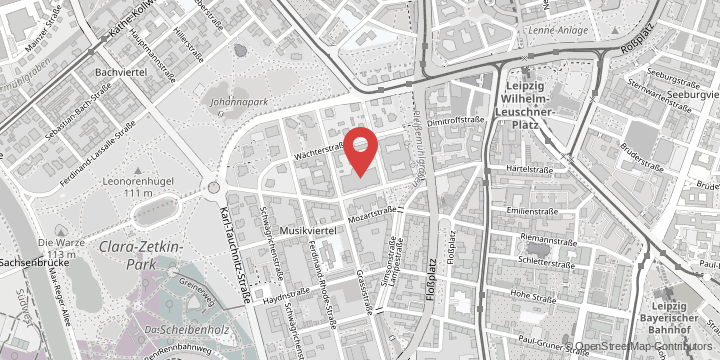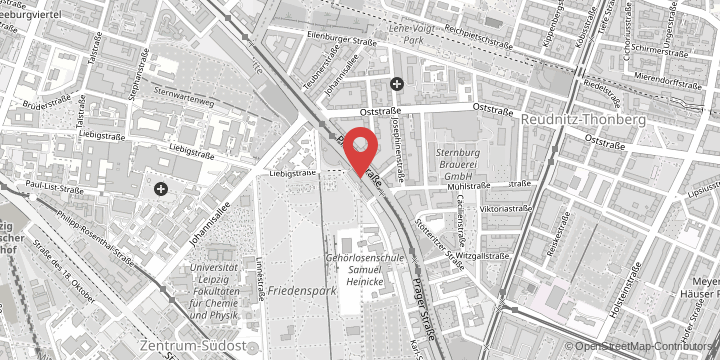"Unser Tastsinnessystem wird gnadenlos unterschätzt", da ist sich Dr. Martin Grunwald, Leiter des Haptik-Forschungslabors der Medizinischen Fakultät, sicher. "Viele glauben, der Tastsinn hilft mir lediglich im Dunkeln den Wecker zu finden und spielt ansonsten nur noch bei sexuellen Handlungen eine wichtige Rolle. Das ist durchaus richtig, aber es ist zugleich eine extreme Verkürzung der grundsätzlichen Lebensfunktionen dieses Sinnessystems." So können Organismen, die nichts sehen, hören oder schmecken überleben - doch kein Lebewesen wäre ohne Tastsinn lebensfähig. Die Anzahl der Rezeptoren im Tastsinnessystem übersteigt die der anderen Sinnessysteme - Schätzungen gehen von einer Zahl im Billionen-Bereich aus.
Besonders Berührungen, "leichte Deformationen der Haut", wie Grunwald sie nennt, stimulieren diese Rezeptoren. Studien mit EEG-Untersuchungen haben gezeigt, dass kurzzeitige Massagen sowohl bei Säuglingen als auch bei Erwachsenen den neurophysiologischen Status eines Menschen zum Positiven hin verändern. "Durch Berührungsreize werden biochemische und bioelektrische Prozesse im Gehirn ausgelöst. Daraufhin werden bestimmte Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet und gebildet, die die Hirnaktivität beeinflussen und den körperlichen Zustand positiv verändern", erklärt der Haptik-Forscher. Durch diese Effekte nimmt die Herzfrequenz ab, die Atmung wird flacher und positive Emotionen entstehen. Eine zehnminütige Massage reicht schon aus, diese komplexen neurobiologischen Prozesse auszulösen. Ein professioneller Masseur ist dabei nicht unbedingt vonnöten.
"Es gilt das biologische Gesetz, dass durch adäquaten zwischenmenschlichen Körperkontakt - ohne sexuelle Intentionen - positive Emotionen in unserem Gehirn ausgelöst werden. Selbst kurze Umarmungen können diese Effekte auslösen. Wer lange Zeit ohne dieses besondere Lebensmittel auskommen muss, kann in seinem seelischen und körperlichen Wohlbefinden durchaus stark beeinträchtigt sein. Wenn es draußen trüb, kalt und nass ist, müssen wir aktiver für unser Wohlbefinden sorgen", empfiehlt Dr. Martin Grunwald. So sei es in einer Partnerschaft zu überlegen, ob man nicht mehr Kuschelzeit miteinander verbringt, um den Basiskörperkontakt zueinander zu halten. "Der Mensch hat ein Grundbedürfnis nach solchen Körperinteraktionen vom Kleinkind bis zum Greis. Mit diesem Nähebedürfnis wachsen wir auf. Durch die Körpernähe werden nicht nur Hautverformungen generiert, sondern auch Wärme übertragen und die tut uns gut."
Denn der Mensch nimmt nicht nur Oberflächenstrukturen über den Tastsinn wahr. Er bekommt über ihn auch Informationen über Temperatur, Gewicht, Elastizität oder Rauigkeit. Das beschreibt die sogenannte exterozeptive, also nach außen gerichtete Funktion unseres Tastsinnessystems. Zugleich weiß der Mensch ohne jede visuelle Information, wie der eigene Körper aufgebaut ist: Beine unten, Kopf oben. Diese Information über die Stellung des Körpers im Raum, die propriozeptive Komponente des Tastsinns, verarbeitet das Gehirn permanent. Interozeptiv, also nach innen gerichtet, liefert das Sinnessystem Informationen über bestimmte Organfunktionen wie den Herzschlag oder das Magengrummeln.
Durch Selbstberührungen lässt sich der positive Effekt auf Körper und Geist allerdings nicht erreichen. Etwa 400 bis 800 Mal fasst sich der Mensch täglich ins Gesicht - was genau dahinter steckt, das erforscht Grunwald derzeit mit seinem Team mit finanzieller Förderung der DFG. "Unser Gehirn funktioniert am besten, wenn es sich auf einem mittleren Aktivitätsniveau befindet. Alle biologischen Systeme streben eine Homöostase, also ein Gleichgewicht der Kräfte, eine Balance an", erklärt Grunwald. Im Alltag strömen unzählige Informationen auf den Menschen ein, die das Gehirn verarbeitet oder unterdrückt. Einige davon sind jedoch in der Lage, das System aus dem Gleichgewicht zu bringen, etwa sehr starke positive oder negative Emotionen. Um die Balance der Hirnaktivität in derartigen Situationen wiederherzustellen, wird nach Ansicht von Grunwald eine gesichtsbezogene Selbstberührung ausgelöst. Der Berührungsreiz wird dann vom Gehirn so verwertet, dass der Balancezustand wieder hergestellt ist. "Derzeit stehen wir allerdings noch ganz am Anfang, diesen komplexen biologischen Prozess der Selbstberührung zu verstehen. Besonders spannend ist dieses Alltagsphänomen auch deshalb, weil bereits der Fetus im Mutterleib Selbstberührungen des Gesichts ausführt." Welchen Unterschied es für die Hirnaktivität macht, ob sich der Mensch mit der linken oder rechten Hand berührt, will Haptik-Forscher Dr. Martin Grunwald jetzt noch herausfinden.